Herzerweichend
(aus: Ö1-GEHÖRT, Dezember 2022)
Da Weihnachten naht, sollte auch mal erwähnt sein: Das Internet ist ein Netz der Herzen. Also wenn man die Diskussionskultur auf Twitter außer Acht lässt, und die auf Facebook, und jene auf Telegram, und…
Egal. Ich bekomme immer wieder herzzerreißende Mails von Menschen aus aller Welt. Eines möchte ich heute herausgreifen, jenes der 22jährigen Waise Koffi Aya. Ihr Vater war ein wohlhabender Kakaohändler in Abidjan und ist es, wie es das Imperfekt andeutet, nun nicht mehr. Er wurde auf einer Geschäftsreise vergiftet. Die Mutter starb schon bei der Geburt (also von Koffi Aya). Ihr Vater hat Koffi Aya ein kleines Vermögen hinterlassen, „die Summe von (7.500.000,00) sieben Millionen fünfhunderttausend US-Dollar“. Und trotzdem ist Koffi Aya kein glückliches Mädchen. Ihr drogenabhängiger Onkel ist nämlich hinter ihr beziehungsweise dem Geld der jungen Frau her, obwohl er schon 2019 alle Immobilien seines toten Bruders verkauft hat, dieser elende Knilch.
Nun sitzt die Bedauernswerte in einem Hotel in Abidjan und sucht Hilfe, namentlich einen Menschen mit Konto, auf welches sie ihr Erbe transferieren kann, um es „für Investitionszwecke wie Immobilienverwaltung oder Hotelmanagement“ verwenden zu können. Dafür würde mir die Ehrwürdige sogar 20 Prozent der Gesamtsumme anbieten.
Weil nun Weihnachten kommt und zu dieser Zeit die Herzen so sperrangelweit offenstehen wie die Punschhütten, bin ich natürlich bereit, ihr die Bankspesen von ca. 70.000 Euro vorzustrecken. Versteht sich von selbst, wo Koffi Aya mir doch so viel Vertrauen entgegenbringt. Wer nun meint, ich würde dem klassischen Vorschussbetrug, auch Nigeria-Scam genannt, aufsitzen, den kann ich beruhigen: Meine Naivität ist im wahrsten Sinne des Wortes grenzenlos.
Was ich den Kriminellen zu Gute halte: So eine Bollywood-taugliche Räuberpistole kommt bei mir weitaus besser an als die Romantik-Masche (Love Scam), bei der einem genauso das Geld aus der Tasche gezogen werden soll.
Ganz unromantisch hat es auch die Unaussprechliche erwischt: Ashokan bietet ihr von einer indischen Adresse aus den Beitritt zum „Welteliteimperium der Illuminaten“ an. Sie lernt, äh spart schon für die Aufnahmsprüfung. Auf dass die Liebste erleuchtet werden möge, ohne illuminiert zu sein.
Bot-Landung
(aus: Ö1-GEHÖRT, November 2022)
Jüngst rief mich die Liebste gekränkt an. Sie stand irgendwo in Frankreich mit annulliertem Flug und hatte gerade eine Auseinandersetzung mit Maria hinter sich. Maria ist der Chatbot einer Fluglinie, also ein automatisches Konversationsprogramm. Maria war nicht willens gewesen, meine Herzensfrau umzubuchen, weil sie selbige nicht in den Passagierlisten gefunden hatte.
Dass ich mit Kara dieselbe Erfahrung gemacht hatte (der Chatbot eines Mobilfunkbetreibers), tröstete die Liebste nicht. Wobei der Kontakt-Button auf Webseiten meist ohnehin sehr gut versteckt ist. Zuerst sucht man verzweifelt in der Navigation oben, dann scrollt man gefühlte 350 Meter bis ans Ende der Webseite, um endlich bei einem in 6-Punkt-Schrift gesetzten Link anzukommen. Kann man ihn ohne Blindenhund lesen, entdeckt man dahinter oft auch eine Telefonnummer. Aber wehe, man macht den Fehler, sie zu wählen. Dann öffnet man wie im Märchen eine verbotene Tür und wird in den homo warteschleifensis verwandelt. Das macht grantig, weil der akustische Warteraum Kommunikation nur vorgibt und den Kund:innen anschaulich vermittelt, dass sie die größten Störfaktoren im Geschäftsleben sind. (Im Übrigen habe ich wirklich Mitleid mit der Mitarbeiterschaft in den Hotlines der Energieversorger, die derzeit schuldlos beschimpft werden und deren Telefonaufkommen sich verzehnfacht hat…)
ABER ICH HÄTTE GERNE ANTWORTEN AUF MEINE FRAGEN!
Als neuen Wall gegen Kundenanfragen und -beschwerden setzen viele Firmen nun eben Chatbots ein, die sich mit technomythischen Vokabeln wie Künstliche Intelligenz oder Machine Learning brüsten. Im besten Fall fischen die Elektrodamen (meist bekommen digitale Dienstboten Frauennamen…) aber nur stichwortgesteuert in einem Antworten-Pool für 08/15-Fragen, etwa im Stil des Wienbots. Das ist nur mäßig befriedigend. So verwundert es nicht, dass eine deutsche Untersuchung Chatbots als „Hype für den vernetzten Kunden“ bezeichnet, der kein „in vollem Umfang zufriedenstellendes Erlebnis“ bieten kann. Da lobe ich mir die Ehrlichkeit der ÖBB-Warteschleife (ich liebe die Bundesbahnen und ihre Züge übrigens nach wie vor). Nach 23 Minuten fiel ich einfach raus, ohne dass jemand vorgetäuscht hätte, mit mir kommunizieren zu wollen.
Ein bissi Doomsday
(aus: Ö1-GEHÖRT, Oktober 2022)
Meine Fußballgruppe hat das Fußballspielen aufgegeben und trifft sich jetzt zum Diskutieren. Da sich die Leute nicht mehr beim Kicken verletzen, leben sie ihren Masochismus anders aus: Sie nennen sich aus mir unerfindlichen Gründen „Old Men’s Club“. Ich bin einer der Ältesten. Ich mag sie trotzdem. Aber halt „trotzdem“.
Jüngst kam die Rede auf unseren Nachrichtenkonsum. Dabei outeten sich viele, sie würden Nachrichten so gut wie verweigern, vor allem in Sozialen Medien.
Meine Kollegin Irmi tauchte wenig später mit einem Begriff auf, der diese News-Verweigerung in ein neues Licht setzte: Doomscrolling. Das ist die Endlosschleife negativer Nachrichten, von Pandemie über Krieg bis Klimakrise.
Soziale Medien bilden diese Endlosschleife leider geradezu fatal ab. Sie sind dauernd „auf Sendung“. Sie kennen keinen Beginn und kein Ende (weshalb ich diese Kolumne als Ode an Anfang und Ende geplant hatte). Von der neuen Rekordhitze scrollt man weiter zu einem russischen Raketenangriff und weiter zu neuen CO2-Spitzenwerten in der Atmosphäre und weiter dem Weltuntergang entgegen. Doomscrolling eben.
Wen wundert es da, dass die Berliner Charité in einer Untersuchung einen starken Zusammenhang zwischen Dauer und Häufigkeit des Medienkonsums mit Symptomen von Angst und Depression fand. Besonders schlimm waren die negativen Nachrichten-Wirkungen, wenn die Befragten sich ihre Informationen vor allem aus Sozialen Medien holten. Diese Formate kennen keine Pause. Zudem fehlt, wie die Forscher:innen bemerkten, die Einordnung. Wenn die Gefahr so unmittelbar in die Intimsphäre eindringt, tut man sich schwer, sich aus dem Bedrohungsszenario zu befreien und taucht stattdessen immer tiefer ein.
Klassische Nachrichtenformate – von Zeitung bis zu TV- und Radio-Sendungen – sind zeitlich oder räumlich limitiert. Sie haben, anders als das unendliche Netz, Grenzen. Und die können sehr wohltuend sein. Was nun nicht gegen Soziale Medien spricht. Sie brauchen nur einen distanzierten Umgang, weil sie uns sonst aufgrund ihrer Endlosigkeit auffressen. Viele Episoden unseres Lebens scheinen nach Anfang und Ende zu verlangen.
Insofern ist es auch okay, dass die Fußballabende endeten, old men.
So ein Drama
(aus: Ö1-GEHÖRT, September 2022)
Im September ziehen wir jetzt also vom Funkhaus in der Argentinierstraße in das neue Ö1-Gebäude auf dem Küniglberg. Es ist ein wunderschön anmutender, lichtdurchfluteter Bau ohne Innenwände. Dies führte bei großen Teilen der Ö1-Belegschaft zur senderinternen Gretchenfrage: Wohin mit unseren Büchern? Nach einer Umfrage belief sich der Regalmeterbedarf auf mehr als einen Kilometer. Schließlich fand das Übersiedlungsteam am neuen Standort ein paar Büchermeter in einem Besprechungsraum. Dies wiederum veranlasste einige Kolleg:innen zu wiederholten, verzweifelten Stimmungsausbrüchen, da man sich das Herz aus dem Leib gerissen wähnte und ohne Buchbegleitung bzw. mit kleinem Buchgepäck nicht übersiedeln wollte.
Dabei bekam auch ich mein Fett ab, da ich die Aggressionen der Regalunterbemeterten ob der Buchbeschneidung für verzichtbar hielt. Meine Bibliothek liegt zu 90% auf einem elektronischen Lesegerät und braucht nur etwa 0,9cm Regal, gemäß dem Diktum: der Weise trägt all das Seine mit sich (Selbstironie).
Grund genug, bei der Leseforschung nachzufragen, ob Lesen auf totem Holz tatsächlich besser ist als vom Bildschirm. Bei der Lektüre von Belletristik gibt es demnach keinerlei Unterschiede. Erzählungen kann man weltweit unabhängig vom Trägermedium gleich gut folgen. Etwas schwieriger wird es bei Sachtexten und -büchern. Die verstehen wir via Bildschirm tatsächlich schlechter. Die Wissenschaft führt dies darauf zurück, dass wir über Monitore oberflächlicher und „flacher“ lesen und zu schnell glauben, Zusammenhänge verstanden zu haben. Außerdem berauben wir uns elektronisch des Glücksgefühls, den Fortschritt beim Lesen zu beobachten und den rechten Buchteil immer dünner werden zu sehen. Aber das empfinden nur Zellulose-Aficionados so. Allerdings: Liegt ein Stapel Bücher neben dem Bett, greifen wir viel eher hin und lesen. Was für den Aufbau einer Bibliothek vor allem für Kinder spricht. Auch ich als „Flachleser“ lebe gern mit solchen animierenden Bücherstapeln. Trotzdem bin ich froh, dass meine geschätzten Kolleg:innen wenigsten ihre Pixie-Bücher nicht übersiedeln wollten.
Die 100. Kolumne: Das Klo-Desaster
(aus: Ö1-GEHÖRT, August 2022)
Die Absichten waren wieder einmal echt gut. Aber dann kam die Wirklichkeit dazwischen.
Ich ortete bei meinen Buben erhebliche lyrische Defizite. Was ja irgendwie kein Wunder ist, da sie im Fach Deutsch gefühlt jeweils ein Jahr lang Bildgeschichte, Inhaltsangabe oder Leserbrief durchnehmen (bitte, lieber Lehrplan, kannst du endlich das 21. Jahrhundert erreichen?).
Also baute ich einen Gedichteapparat und selbigen ins Klo ein. Wenn jemand das Licht einschaltet, spielt das Gerät per Zufallsprinzip Lyrik ab. Da ich in meiner Vergangenheit öfter mit H.C. Artmann Lesungen oder Studioproduktionen aufgenommen hatte und er im Vorjahr 100 Jahre alt geworden wäre, wählte ich rund 50 Gedichte seines legendären Werks med ana schwoazzn dintn als Einstiegs-Poesie. Begibt man sich also auf das stille Örtchen, wird man entweder von Blaubarts Mordabsichten überrascht, hört HC zu, wie er sich sein Herz um 4 Uhr früh ausreißen möchte waun de aumschln schrein, oder lauscht dem Liebesgeflüster alanech fia di, wobei dies auch das Motto für den Aufenthalt auf der Toilette sein könnte, denn nirgendwo sonst ist man so sehr „für sich“ wie dort.
Soweit der Plan. Als erstes änderte sich einiges in der häuslichen WC-Logistik zum Positiven. Die Buben benutzten plötzlich viel häufiger ihre eigene Toilette im Untergeschoß. Dann folgte der Aufstand: „Papa, kannst du den Mann nicht abstellen, der dauernd am Klo redet?“
Hernach wurde toilettale Dunkelheit in Kauf genommen, um nur ja nicht von den Dialektgedichten gestört zu werden.
Als die Buben nach 4 Monaten noch immer nicht wussten, wer da gelegentlich zu ihnen spricht, bekam mein technologisch-kulturelles Selbstbewusstsein eine heftige Delle. Ich versprach, das Lyrikprojekt zu beenden, sobald sie mir zumindest den Namen des Dichters sagen können. Weitere 2 Monate später konnten sie den Poeten benennen, wobei ich glaube, dass da die Unaussprechliche auch im Spiel war. Womöglich fühlte sie sich von einem (Art-) Mann am Klo belästigt. Wie auch immer, ab nächster Woche läuft dort das nächste Bildungsprogramm: Vogelstimmen.
Echt matt
aus: Ö1-GEHÖRT, Juli 2022)
Es ist Sommer. Und der verlangt nach einem Lob der Faulheit in diesen getriebenen Zeiten. Nach Wochen des verschärften Rackerns ist der Unaussprechlichen und mir manchmal auch der kurze Weg in den Garten zu weit und die Terrasse das Habitat unserer Erschöpfung. Mit digitaler Hilfe – also vielen Apps – kann man dort trotzdem einiges erleben, ohne einen Schritt gehen zu müssen. Ein Blick auf das Handy sagt mir, dass es meiner Kaffirlimette gut geht. In meiner naiven Begeisterung für primitives Programmieren habe ich sie mit einem Funksensor versehen. Einige meiner Freunde glauben nun, sie könnten von der funkenden Thai-Curry-Zutat auf meine geistige Gesundheit schließen.
„Mönchsgrasmücke“, sagt die Liebste auf ihrer Liege und deutet auf die App Birdnet. Das ist der Vogel, der schon um fünf Uhr früh fröhlich aus der Föhre gepfiffen hat, ohne dass ich seine Fröhlichkeit irgendwie erwidern hätte können. Das „Vogel-Shazam“, wie die Unaussprechliche den Vogelstimmen-Decoder nennt, hat unser Gartenleben extrem bereichert. Jetzt stimmt auch noch eine Klappergrasmücke ein. Den Buchfink kennen wir mittlerweile schon ohne Smartphone.
Müde hebe ich die Hand und deute auf einen Kondensstreifen. „Florenz“, murmle ich, weil Flightradar mir das Ziel des Fluges nennt. Und würde ich die paar Wienerwaldhügeln in meinem Gesichtskreis nicht ohnehin kennen, könnte ich sie mit PeakAR identifizieren. Um sie in den Bergen zu nutzen, müsste ich mich erst einmal bewegen. Aber das geht grad nicht, siehe oben.
Die erschöpfte Frau auf der Liege neben mir startet „Lascia mi fare“ von Wanda auf ihrem Musikdienst und seufzt ob der Anstrengung des Tippens. Ich versuche schnell, zehn neue Italienischvokabeln von der Handy-App zu lernen, aber nach fünf gebe ich auf, weil ich dazu meinen Kopf heben müsste. „Wir können noch drei Stunden so liegenbleiben“, flüstert die Liebste. „Nur?“, frage ich. „In drei Stunden kommt ein Regenguss, sagt die Wetter-App.“
Ich bin längst eingedöst, als das Handy grauslich fiept. Die Kaffirlimette schreibt mir. „Bitte Wasser!“ Aber dazu müsste ich aufstehen. Vielleicht lasse ich sie einfach mal auf Diät.
Mann und Maschine
(aus: Ö1-GEHÖRT, Juni 2022)
Wenn die Unaussprechliche ein Update im Wohnzimmer macht, schaut das so aus: In Stufe 1 schimpft sie furchtbar mit mir, nur weil der 3D-Drucker nebst einigen Schrauben, Kameras, Zangen, Alexas und Arduinos ihrer Meinung nach schon zu lange am Sideboard weilt. Am Schluss der Tirade nennt sie mich rituell einen Messie. Ich entgegne in Stufe 2, ich würde mit Unordnung nur ehrlich und transparent umgehen, während sie in ihrem musealen Wahn das ganze Haus in eine einzige Ausstellung verwandeln will. Außerdem: Warum darf die Trophäe eines Kudus (bekamen wir von einem nahestehenden Jäger) samt ironisierenden rosa Mascherln an der Wand hängen, während mein Drucker weichen muss? Was macht einen affichierten Tierkadaver besser als meine herumliegenden Mikrocomputer?
In Stufe 3 räume ich alles weg.
Immer wieder tun sich bei uns Gräben auf, die exakt entlang der Geschlechtergrenzen verlaufen. Im Auto deponiert die Liebste ihre Notebooktasche immer störend auf der Mittelkonsole und kritisiert, dass nur ein Mann so eine doofe Karre ohne Taschenablage entwerfen kann. Mein Notebook findet hingegen im Kofferraum Platz, in dem wir gut und gern einen Großrechner unterbringen würden.
Wenn ich mich abends an den Tisch setze (den Sessel dürfen wir als ziemlich einzigen Einrichtungsgegenstand im häuslichen Museum noch bewegen), dann muss ich der Frau im Haus durchaus auch Recht geben.
Technik wird immer noch vorwiegend von Männern für Männer gemacht, auch wenn Rollenbilder veränderbar sind (notwendig wär’s). Die wenigen Software-Entwicklerinnen, die es gibt, programmieren oft für sozial orientierte Bereiche wie Projektmanagement. Techniknahe Felder gestalten ganz klischiert die Männer. Partizipative Technikgestaltung, die die Anwender:innen einbindet, ist noch immer nicht sehr verbreitet. Und wenn Algorithmen Bewerber:innen für Top-Jobs auswählen, suchen sie zum Großteil Männer aus, weil sie an Daten der Vergangenheit gelernt haben. Selbst Google zeigt Frauen, laut Carnegie Mellon University, weniger hochbezahlte Jobs an als Männern. Die Digitalisierung ist auf dem weiblichen Auge zum Teil blind.
Wäre sie das nicht, würde sicher jemand einen hübschen 3D-Drucker erfinden, den man dekorativ an die Wand hängen kann. Wie ein Kudu.
Läuft
(aus: Ö1-GEHÖRT, Mai 2022)
Eines vorweg: Was Sie hier gleich lesen werden, schreibe ich mit ausdrücklicher Genehmigung der Unaussprechlichen. Es ist nämlich so, dass sich der Sommer nähert. Die Liebste hat also die Deka zusammengezählt, die sie unter ihren Kleidern stören, und einen Schrittzähler an ihr Handgelenk geschnallt. Der Mann an sich kann in solchen Fällen hundertmal betonen, dies sei vielleicht aus Gründen der Fitness gut, aber morphologisch völlig unnötig: Es wird ihm sowieso nicht geglaubt. Deshalb passiert es jetzt öfter, dass die sportbewegte Frau um 23.51 Uhr auf ihre schrittzählerbewehrte Uhr schaut, erschrocken aufschreit, eine vierstellige Zahl ruft, die noch fehle, und dann wiederholt die Wendeltreppe rauf und runter hüpft, als würde das flinke Geißlein von einer Hornisse verfolgt.

So recht vertraue ich dem Ding am Handgelenk der Liebsten ja nicht. Denn vor einiger Zeit überstellten wir für den Schwiegervater ein waldgängiges Auto in den Süden Österreichs. Es war eines dieser Retro-Gefährte mit einem einzigen elektronischen Bauteil (Zündkabel samt Batterie), das offenbar auch völlig auf Stoßdämpfer verzichtet hatte. So holperten wir denn gen Kärnten. Als wir nach dem Ritt ausstiegen, zeigte der Schrittzähler der Unaussprechlichen 57.000 Schritte an und die Bandscheiben brummten ein dunkles Lied.
Nun hat die Frau meines Herzens entdeckt, dass sich ein ähnlicher Effekt auch beim Zwiebelhacken erzielen lässt. Jüngst bereitete sie deshalb um halb zwölf Uhr nachts noch ein Curry für die Buben zu, weil dies die Zahl an ihrem Handgelenk schnell gen 10.000 trieb.
Ich trage mich bereits mit dem Gedanken, ein Kochbuch unter besonderer Berücksichtigung seiner schrittvermessenden Tauglichkeit zu verfassen. Zuoberst würde ich Gulasch empfehlen, wenn denn noch etwas zur formalen Fitness fehlt (ebenso viel Zwiebel wie Fleisch, als Grundregel. Man kann es auch mit Soja zubereiten, um die Rinder zu verschonen).
Wenn die Liebste laufen geht, vergisst sie übrigens eh auf den Schrittzähler. Weshalb ich diese Kolumne mit ihrem Einverständnis auch liebevoll „Und sie bewegt sich doch“ nennen wollte.
Oh, es riecht nach Gulasch.
Der Sommer kann kommen.
Wer den Schaden hat
(aus: Ö1-GEHÖRT, April 2022)
Es sieht danach aus, als würde ich meine liebe Kollegin Jutta an das Metaversum verlieren. Die Tür dazu hat das berüchtigte Virus aufgesperrt. Als Jutta krankheitsbedingt mit Mann Oskar und Kind in der Wohnung eingeschlossen war, schaffte sich die Familie eine Datenbrille an. Man wollte sich schließlich ein bisschen bewegen und „raus“ aus der Quarantäne-Zelle, wenn auch nur virtuell.
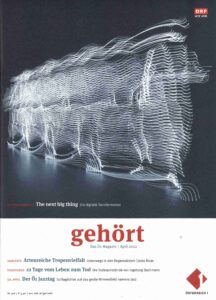
Oskar lud sich also ein Spiel in seine Datenbrille, setzte sie auf und betrat die Star Wars-Welt. Er schlich in Darth Vaders Schloss. Und was jetzt kommt, hat Jutta durch Zufall auf Video dokumentiert. Sie war ja gegen die Anschaffung der VR-Brille und fürchtete Ungemach für die Wohnungseinrichtung. Da steht Oskar also mitten im Raum und fuchtelt mit einem unsichtbaren Laser-Schwert. Er dreht sich nach rechts. Plötzlich hüpft er panisch zur Seite, macht zwei Fluchtschritte nach links und stürzt über den Esstisch (nicht den von Darth Vader, sondern den in der Wohnung). Ein (echtes) Glas zerbricht, (echter) Rotwein verteilt sich über die Tischplatte. Oskar liegt im Eck und reißt sich die Datenbrille vom Kopf.
Er hatte sich erschreckt, weil unvermittelt die Stormtroopers ins Schloss marschiert waren, um ihn anzugreifen.
Das Video zirkuliert jetzt in unserem sozialen Netzwerk (ich meine das wörtlich, weil man öfters vergisst, dass es solche Netzwerke auch in Echt vulgo offline gibt) – und dieses wunderbare Netzwerk ist unsere Digital.Leben-Redaktion. Jutta will den Slapstick-Film mit Höchstpotential für ein Internet-Meme auf gar keinen Fall per Messenger schicken. Wir dürfen ihn nur beim Mittagessen auf ihrem Handy anschauen. Bald wird sie sich mit Kaffee dafür zahlen lassen.
Jutta trainiert seit Oskars Star Wars-Episode übrigens mit der VR-Brille. Sie boxt gegen sieben andere Menschen und wird zu ihrem Leidwesen immer nur Fünfte. Eigenen Aussagen nach nutzt sie die Datenbrille viel häufiger als Oskar, der sie angeschafft hat.
Zuletzt hat sie ihrem Mann beim Training übrigens einen heftigen Faustschlag versetzt, den wir Oberösterreicher malerisch als „Magenstamperl“ bezeichnen. Ich hoffe, Juttas Beziehung übersteht das Metaversum.
Reingefallen
(aus: Ö1-GEHÖRT, März 2022)
Der treueste Begleiter des modernen Menschen ist nicht der Hund, sondern das Handy. Aber ab und an hat es genug von uns. Dann hüpft es ins Wasser. Im schlimmsten Fall ins Klo. Danach heißt es schnell sein und lange Hände waschen. Dass ich nicht überdramatisiere, habe ich bei einer Umfrage im näheren Bekanntenkreis festgestellt. Und dabei eigentlich noch mehr über das Menschsein gelernt als über Technik, aber der Reihe nach.

Für den Handytod durch Ertrinken gibt es mehrere Varianten. Da sind zuerst einmal die Selbstvergessenen (Schwager Chris und Kollege Rolli): Die lassen das Handy in der Badehose stecken, während sie ins Meer gehen – auch wiederholt. Keines der Smartphones war danach zu retten, aber Rolli zumindest hat es vier handyfreie Urlaubswochen beschert („ein Traum“, sagt er jetzt).
Dann sind da die Rustikal-Originellen: Eva hat ihr Handy in der Einkaufstasche in Schafkäse-Wasser ertränkt. Dem ist nichts hinzuzufügen, außer dass Hartkäse offenbar smartphone-tauglicher ist.
Die weitaus größte Gruppe sind aber tatsächlich die lässigen Klo-Versenker. Als größter Risikofaktor hat sich das Einstecken des Smartphones in der Gesäßtasche herausgestellt (statistisch bestätigt von Martin Kirschkernspucker). Den Glücklicheren fiel das Handy ins WC, während es noch mit kabelgebundenen Ohrhörern versehen war. Ein deutlicher Vorteil bei der Bergung. In Angelikas Fall hat es sogar zu einer Heirat geführt, weil sie das Gespräch mit ihrer Flamme fortsetzen konnte.
Aber wie das Smartphone reanimieren? Die meisten empfehlen, nach dem WC-Watch-Rettungseinsatz sofort den Akku herauszunehmen und das gute Stück in eine Salz-Reis-Mischung zu legen. In der Praxis hat das auch nur bei maximal der Hälfte funktioniert. Wobei es durchaus psychoanalytische Interpretationen derartiger Unfälle gibt: „Manche Handys sind suizidal veranlagt, weil sie das Gelaber ihrer Besitzer nicht mehr ertragen können“, meint Paula.
Eine besondere Untergruppe bei den WC-Versenkern bilden übrigens jene mit wenig Handybindung: Petra etwa fiel der Verlust erst auf, als es aus den Tiefen des Klos läutete.
Disclaimer: Die Studie wurde nach der Beinschab-Methode durchgeführt: online, mit überschaubarer Fallzahl. Trotzdem hat das Finanzministerium sie nicht angekauft.
System Sepp
(aus: Ö1-GEHÖRT, Februar 2022)
Dies ist ein Bericht über den Status der Digitalisierung in Österreich. Es begab sich kurz nach Weihnachten, dass wir die Schwägerin im oberösterreichischen Ennstal besuchten. Beim Kaffee schwärmte selbige über das Click & Collect in der Marktgemeinde. Sie würde nur mehr per Fernbestellung im Ort einkaufen. Wir waren natürlich erstaunt, dass die Geschäfte dort so schnell ihren Weg in die Online-Welt gefunden hatten. “Online?”, fragte die Schwägerin erstaunt. “Online ist gar nichts. Die haben ja nicht mal Webseiten. Nein, wir rufen zum Beispiel im Baumarkt an. Da hebt der Sepp ab und nimmt die Bestellungen entgegen. Und wenn man sagt, man braucht Meisenknödel, dann schreit er ins Telefon, dass er eh gerade vor dem Regal steht und sich das gut treffe. Und dass er dann gleich bei den Schrauben vorbeikomme. Und ob man auch von dort was brauche, oder weiter hinten neue Leuchten, weil da gehe er gerade hin, um eine andere Bestellung abzuarbeiten.”

„Das ist Call & Collect”, verbesserte die Liebste, “so wie vor 100 Jahren”. Die Schwägerin nickte. Das sei ihr auch jetzt erst aufgefallen. Aber das System Sepp funktioniere super, weil es einen eingebauten Empfehlungsmechanismus habe. Kommt der Sepp zum Zeitpunkt des Anrufs etwa gerade bei den Kupferdachrinnen vorbei, preist er sie an, ganz ohne Amazon-Algorithmus, nach dem Motto, “Kunden die Vogelfutter kaufen, haben jetzt vielleicht auch Zeit für den Bau eines neuen Nebengebäudes, weil was sollten sie sonst mit einer neuen Dachrinne anfangen.”
Und da ist jetzt nichts geflunkert. Man wundert sich dann weniger, dass Österreich in vielen Bereichen des Digitalisierungsindex der EU zurückliegt. Die Technik- und Modernisierungsskepsis steckt bekanntermaßen in der österreichischen DNA. Darüber freut sich in Sachen Onlinehandel vor allem das Konto des Amazon-Gründers Jeff Bezos. Denn laut Statista gibt jeder Mensch in diesem Land im Schnitt 1.600 Euro jährlich im “Distanzhandel” aus. Rund zwei Drittel davon wandern ins Ausland.
Der Sepp mit seinem Telefon kümmert sich derweil um jene knappe Hälfte der Bevölkerung, die mit dem Netz in Sachen Einkauf noch immer nicht viel anfangen kann. Ob sein System zukunftsträchtig ist, wissen wir nicht. Charmant ist es allemal.
Bildschirm und Besorgnis
(aus: Ö1-GEHÖRT, Jänner 2022)
Elternschaft bedeutet unter anderem die Fähigkeit, sich erfolgreich einzureden, man hätte seinen Nachwuchs unter Kontrolle. Leider bekommt dieser Irrglaube immer wieder mal Dellen. Zum Beispiel wenn mir ein Streaming-Anbieter über den Familienaccount schreibt, man möge doch auch die letzte Folge von “Stranger Things” zu Ende schauen. Drei Staffeln lang habe ich nicht bemerkt, dass Schnittlauchlocke auf seinem Notebook nicht Excel übt, sondern sich eine Serie reinzieht.

Der Medienkonsum, insbesondere der am Handy oder Notebook, ist auch bei uns Dauerthema. Er nimmt mitunter dramatische Züge an, was sich etwa in diesem Dialog Mitte Oktober spiegelt. Der Große kommt atemlos aus dem Garten: “Ich hatte eben ein Nahtoderlebnis!”. Ich, gewohnt empathisch: “Du hast dein Handy zertrümmert?”. Der Große: “Nein, eine Biene hat mich attackiert.”
De facto haben drei Viertel der Familie ein sehr inniges Verhältnis zum Smartphone. Um sie von ihrem 6 Zoll großen Fenster zur Welt loszueisen, kam mir jüngst eine Studie gerade recht. Demnach schadet Medien-Multitasking Kindern. Wer also vor dem Fernseher sitzt und dabei auch noch auf sein Handy schaut, stresst sich unnötig. Außerdem hätten die Multitasking-Kinder eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne, mehr soziale und emotionale Problem und würden auch schlechter schlafen. Einen kausalen Zusammenhang konnte das Schweizer Forschungsteam allerdings nicht feststellen. Überbordend war auf jeden Fall die erhobene Mediennutzungsdauer. Zwölfjährige verbringen im Schnitt acht Stunden täglich vor einem Bildschirm. Das entspricht nun nicht einmal mehr den liberalsten Empfehlungen. Natürlich habe ich nach dieser Statistik sofort die außerschulische Bildschirmzeit des Kleinen aufsummiert. Zu meiner Erleichterung lag sie weit darunter.
Und so schwanken die Unaussprechliche und ich wöchentlich zwischen einem alarmistischen Zugang zu übermäßiger Bildschirmnutzung und dann wieder Gelassenheit, weil wir trotz aller Technologie noch sehr viel miteinander reden, diskutieren und streiten. Was ich ein gutes Zeichen finde.
Schnittlauchlocke hat die Studienzusammenfassung übrigens bis zum Ende gelesen und gekontert, er müsse mehr Video spielen, weil das so einen positiven Effekt auf seine kognitive Entwicklung hätte.