Es ist demütigend
(aus: Ö1-GEHÖRT, Dezember 2021)
Im Grund hat sich die Misere schon vor drei Jahren angekündigt. Damals waren die Unaussprechliche und ich bei einem Rock-Festival. Nach drei aufeinanderfolgenden Konzerten meldeten sich unsere Skelette so penetrant, dass wir nach einer Sitzgelegenheit suchen mussten. Die gab es naturgemäß nicht. Wir setzten uns also auf den Betonsockel eines Verkehrszeichens. Was zum nächsten Problem führte: Wir konnten kaum mehr aufstehen. Lösen ließ sich das persönliche Gravitationsproblem nur durch ein ziemlich würdeloses, mit Slapstick-Elementen durchsetztes Aufrappeln. Deshalb, liebe Rock-Festival-Veranstalter: Wenn ihr wollt, dass auch Über-45jährige zu euch kommen, dann denkt doch mal an eine Bestuhlung, zumindest für „erfahrene“ Besucher/ innen.

Wer nun glaubt, die digitale Welt sei gegenüber Menschen mit bereits längerer Biografie toleranter, irrt leider, wie mir erst letzte Woche wieder bewusst wurde, als ich mich für eine Reise registrierte. Ich brauche immer mehr Lebenszeit, um beim Eintragen meines Geburtsdatums zum richtigen Jahr hinunter zu scrollen. Es gibt Menschen, die in dieser Zeit eine ganze Wurstsemmel essen. Bin ich nicht ganz fit, versuche ich derlei Eingaben erst gar nicht. Muss ich an drei aufeinander folgenden Tagen mein Geburtsjahr auf Webseiten eintragen, benötige ich einen Physiotherapeuten, Spezialgebiet Zeigefinger. Es ist demütigend. Ich schlage daher den „historischen“ Modus vor: Die Scroll-Listen beginnen mit der Voreinstellung aktuelles Jahr minus gesetzliches Pensionsantrittsalter. Was würde ich mir an Mausarbeit ersparen.
Die Liebste wiederum drückt mir öfter das Handy in die Hand, weil ihre Arme zu kurz werden. Aus etwa drei Meter Entfernung kann sie meist alles lesen. Aber viel mehr hat sie sich beklagt, dass ihr in sozialen Medien jetzt ständig Werbungen für Hörgeräte eingespielt werden. Und sie ist echt noch jung. Und hat Adlerohren. Bei der Heizdecken-Reklame, die hin und wieder auf den personalisierten Webseiten auftauchen, verdreht sie nur mehr die Augen. Das einzig Beruhigende ist, dass die Social Media-Algorithmen offenbar doch nicht gut genug sind, um zu wissen, wie fit wir sind. Und dass wir nicht frieren.
Es war echt gut gemeint
(aus: Ö1-GEHÖRT, November 2021)
Zwischen einem Wissenschaftsjournalisten-Paar kann selbst Sadismus rührende Züge annehmen. Man neckt sich einfach mit nicht-evidenzbasierter Medizin. Und das kam so: Im letzten Winter schafften es die Liebste und ich nach einer Infektionskrankheit kaum über die Wendeltreppe. Da sich der Zustand auch nach Wochen nicht besserte, schickte uns eine Freundin eine Batterie von Zuckerkügelchen in Glasröhrchen. Sie trugen teils unaussprechliche Namen wie Eupatorium perfoliatum C30. Und sie sind weit weg von den Anforderungen, die wir üblicherweise an Therapien stellen. Die Unaussprechliche – sie ist auch der informelle Familiendoktor – drängte in ihrer Verzweiflung die ganze Familie, samt den weitgehend symptomlos gesundeten Kindern, die Globuli zu nehmen. Was bei der Minderheit – den drei männlichen Mitgliedern – zu anhaltendem, aber erfolglosem Widerstand führte.
 Tage später buken Schnittlauchlocke und seine Mutter Lebkuchen. Der Kleine dekorierte die Herzen. Und ich sah, wie er heimlich ein kleines Glasröhrchen aus seiner Hosentasche zog und mit den Dekorzuckerkügelchen vertauschte. Als die Liebste wegschaute, kippte er den Inhalt auf den erstarrenden Zuckerguss. Kurz danach verzehrte er den Lebkuchen. „So, jetzt habe ich eine Hochpotenz gegessen!“ Sprach’s und zog fröhlich von dannen. Damit endete der gutgemeinte Therapieversuch.
Tage später buken Schnittlauchlocke und seine Mutter Lebkuchen. Der Kleine dekorierte die Herzen. Und ich sah, wie er heimlich ein kleines Glasröhrchen aus seiner Hosentasche zog und mit den Dekorzuckerkügelchen vertauschte. Als die Liebste wegschaute, kippte er den Inhalt auf den erstarrenden Zuckerguss. Kurz danach verzehrte er den Lebkuchen. „So, jetzt habe ich eine Hochpotenz gegessen!“ Sprach’s und zog fröhlich von dannen. Damit endete der gutgemeinte Therapieversuch.
Glücklicherweise blieben wir wenigstens von der Cyberchondrie verschont. Das ist die häufig zu beobachtende Angewohnheit, Krankheitssymptome zu googlen. Was dazu führt, dass man sich schon nach wenigen Minuten deutlich kränker fühlt als noch vor dem Suchvorgang, wie eine Studie der Universität Köln gezeigt hat. Überhaupt ist es nicht einfach, sich im Netz zu Gesundheitsthemen zu informieren. Es soll mehr als 13 Millionen deutschsprachige Seiten dazu geben. Und die allermeisten Internetbenutzer/innen (60%) klicken gleich auf die erste Seite, die ihnen von der Suchmaschine angeboten wird. Die deutsche Verbraucherzentrale hat deshalb unter www.faktencheck-gesundheitswerbung.de Tipps gesammelt, wie man seriöse von unseriösen Gesundheitsseiten unterscheidet.
Auf unserem Schreibtisch habe ich übrigens noch vier verwaiste Röhrchen mit Globuli entdeckt. Ich bin gespannt, wie heuer die Lebkuchen aussehen.
Gesichtsdilemma
(aus: Ö1-GEHÖRT, Oktober 2021)
An meinem Telefon entdecke ich immer wieder neue, überraschende Seiten (an mir auch, aber das ist eine andere Geschichte). Zum Beispiel kann das Fotoalbum nach bestimmten Gesichtern suchen. Tippe ich auf das Konterfei meines Bruders Christian, zeigt es mir sofort Bilder von einem Radausflug in den burgenländischen Seewinkel.
 Die Technologie der Gesichtserkennung hat aber nicht nur ihre schönen Seiten. Der Komfort im digitalen Bilderalbum bekommt einen recht schalen Beigeschmack, wenn Staaten oder Privatunternehmen exzessiv dazu greifen. So hat etwa die Firma Clearview AI wahllos das Netz nach Fotos von Menschen durchforstet, 3 Milliarden Porträts gesammelt und bietet die automatische Gesichtserkennung nun als Dienstleistung an. Die Bürgerrechts-NGO Privacy International hat dagegen in Ländern wie Österreich Beschwerde eingelegt.
Die Technologie der Gesichtserkennung hat aber nicht nur ihre schönen Seiten. Der Komfort im digitalen Bilderalbum bekommt einen recht schalen Beigeschmack, wenn Staaten oder Privatunternehmen exzessiv dazu greifen. So hat etwa die Firma Clearview AI wahllos das Netz nach Fotos von Menschen durchforstet, 3 Milliarden Porträts gesammelt und bietet die automatische Gesichtserkennung nun als Dienstleistung an. Die Bürgerrechts-NGO Privacy International hat dagegen in Ländern wie Österreich Beschwerde eingelegt.
Auch in Österreich setzen Strafverfolgungsbehörden seit 2019 die automatische Gesichtserkennung ein, um Fahndungsbilder abzugleichen. Die Technologie sollte angeblich gegen Terroristen und Schwerverbrecher helfen und wurde rund 1600mal verwendet. Tatsächlich identifizierten die Behörden damit vor allem Kleinkriminelle – was ja durchaus legitim ist. Man soll dann aber bitte nicht mit dem Kampf gegen das große Verbrechen argumentieren.
Dass biometrische Daten und ihre Verarbeitung nachhaltigen Sprengstoff bieten, zeigte Afghanistan. Dort erbeuteten die Taliban von westlichen Armeen wie den USA Geräte, die vertrauenswürdige Personen u.a. aufgrund ihrer Gesichtsmerkmale identifizierten. Die Taliban haben nun eine Datenbank von Kollaborateur/innen mit dem Westen.
In Europa nutzt man die Gesichtserkennung auch in Echtzeit, um zum Beispiel in Fußballstadien Risikopersonen zu identifizieren. Seit einigen Monaten bemüht sich die Initiative #reclaimyourface deshalb um ein Verbot der automatischen Gesichtserkennung. Eines ihrer Argumente: dabei handle es sich um in der EU verbotene Massenüberwachung. Außerdem: Bei einer unbestritten hohen Trefferrate von 99% wird jeder Hundertste zu Unrecht zum Beschuldigten.
Und das ist weitaus schlimmer, als wenn mir mein Fotoalbum bei der Suche nach Christian-Porträts meine zwei anderen Brüder zeigt. Die sehe ich nämlich auch gerne.
Das war anstrengend
(aus: Ö1-GEHÖRT, September 2021)
Urlaube sind meist Offenbarungseide. In der arbeitsfreien Zeit verstellt plötzlich nichts mehr den Blick auf die Beziehung, was durchaus erschütternd sein kann. Nein, der Liebsten und mir geht es ausgezeichnet. In unserem Fall betraf es die Beziehung zu unseren elektronischen Hosentaschen-Helferleins.
 Nach zwei Jahren Österreich war heuer wieder mal das ans Meer grenzende Ausland fällig. Sizilien also. Schon im Vorfeld hatte Schnittlauchlocke einen Mordsstress, ob er wohl alle Adapter, USB-Alpha bis Omega-Kabel zum Laden usw. eingepackt hatte, dazu Reichweitenverlängerer, falls ihm mal unterwegs der Strom ausgehen sollte. Beim Eintritt ins Hotelzimmer wird zuerst einmal alles auf der Suche nach dem WLAN-Passwort auf den Kopf gestellt, um nicht zu sagen gestürmt. Die Cobra wirkt im Vergleich dazu wie eine Abteilung der Sängerknaben.
Nach zwei Jahren Österreich war heuer wieder mal das ans Meer grenzende Ausland fällig. Sizilien also. Schon im Vorfeld hatte Schnittlauchlocke einen Mordsstress, ob er wohl alle Adapter, USB-Alpha bis Omega-Kabel zum Laden usw. eingepackt hatte, dazu Reichweitenverlängerer, falls ihm mal unterwegs der Strom ausgehen sollte. Beim Eintritt ins Hotelzimmer wird zuerst einmal alles auf der Suche nach dem WLAN-Passwort auf den Kopf gestellt, um nicht zu sagen gestürmt. Die Cobra wirkt im Vergleich dazu wie eine Abteilung der Sängerknaben.
Nach ein paar Tagen mieteten wir ein Auto. Das war zumindest so lange spannend, bis wir heraußen hatten, welche Hälfte der Straßenverkehrsordnung auch in Sizilien gilt. Danach fixierten die Buben ihren Blick wieder auf das Smartphone.
In der ersten Reihe des Wagens stieg der Zynismus-Pegel. Ich schlug den Buben vor, die Landschaft doch live durch die Handykamera zu betrachten, weil sie dann vielleicht realer wirkt. Später kam mir eine prima Geschäftsidee: eine Rasterfolie für Autofenster, die das Bild in kleine Punkte zerlegt. Dann hätten die Kids das Gefühl, ein verpixeltes Abbild der Außenwelt zu sehen. Es käme ihnen wohl viel vertrauter vor. Zynismus Ende.
Ich muss leider selbst gestehen, dass es mir zunehmend schwerer fällt, eine Trattoria ohne Hilfe meines Smartphones zu finden. Richtig spannend wurde es, als wir uns mit dem analogen Stadtplan verliefen. Wir kamen in eine Gegend in Palermo, wo man sich nicht mehr zu fotografieren traut und alle recht freundlich grüßt. Irgendwo krachte es wiederholt furchtbar. Die Buben fragten, ob es Schüsse sind.
Der Ätna hat uns dann alle wieder geerdet. Wir standen doch just an seinem Fuß, als er abends ausbrach. Da wurde das Smartphone wieder zum Fotoapparat, vor lauter Staunen über die Feuersäulen dachte niemand an Instagram-Storys, Snaps oder Facebook-Posts. Aber man kann halt nicht immer einen speienden Vulkan bieten.
Rasenmäherkrieg
(aus: Ö1-GEHÖRT, August 2021)
Ich kenne zwei Menschen, die beim Rasenmähen einen Herzinfarkt erlitten. Da diese Arbeit lebensgefährlich ist, weigere ich mich seit Jahren, unsere biodiverse Gartenwiese zu mähen. Die Liebste hat wie immer die Augen verdreht, und sie kann sie so verdrehen, dass man denkt, ein Kreis habe mindestens 580 Grad. Um ihr ein wenig entgegenzukommen, schaffte ich vor Jahren den ersten Rasenmäherroboter an. Ein Unding. Es warf sich wollüstig auf die Blumen der Unaussprechlichen und hächselte sie kurz und klein, was dem häuslichen Frieden überhaupt nicht zuträglich war. Danach musste ich mit Opas Rasenmäher Frieden stiften, notierte aber jedesmal ostentativ die Notrufnummer der Rettung auf einem DIN-A4-Zettel und klebte ihn auf den Tisch.
 Seit zwei Jahren gibt es nun einen funktionierenden automatischen Rasenmäher. Aber gerade tobt im Netz ein brutaler Richtungsstreit zwischen Rasen-Robo-Befürwortern und – Gegnern. Simmering gegen Kapfenberg nimmt sich dagegen wie ein Lercherl aus, um in der Diktion von Helmut Qualtinger zu bleiben. Die Gegner argumentieren, die autonomen Mäher würden vielen Igeln den Garaus machen, weil sich die Stacheltiere angesichts der heranrollenden Gefahr zusammenrollen und dann aufgeschlitzt werden. Eine im April erschienene Studie mit dem wunderbaren Titel „Wildlife Conservation at a Garden Level: The Effect of Robotic Lawn Mowers on European Hedgehogs (Erinaceus europaeus)“ kann diese Vorwürfe leider nicht entkräften. Trifft Robo-Rasenmäher auf Igel, zieht der Igel meist den Kürzeren.
Seit zwei Jahren gibt es nun einen funktionierenden automatischen Rasenmäher. Aber gerade tobt im Netz ein brutaler Richtungsstreit zwischen Rasen-Robo-Befürwortern und – Gegnern. Simmering gegen Kapfenberg nimmt sich dagegen wie ein Lercherl aus, um in der Diktion von Helmut Qualtinger zu bleiben. Die Gegner argumentieren, die autonomen Mäher würden vielen Igeln den Garaus machen, weil sich die Stacheltiere angesichts der heranrollenden Gefahr zusammenrollen und dann aufgeschlitzt werden. Eine im April erschienene Studie mit dem wunderbaren Titel „Wildlife Conservation at a Garden Level: The Effect of Robotic Lawn Mowers on European Hedgehogs (Erinaceus europaeus)“ kann diese Vorwürfe leider nicht entkräften. Trifft Robo-Rasenmäher auf Igel, zieht der Igel meist den Kürzeren.
Allerdings sind Igel nachtaktive Tiere. Es gibt keinen Grund, nachts zu mähen. Zudem könnte man die Mäher in Zukunft mit Ultraschallsensoren auszustatten, die kleine Tiere erkennen. Darüber hinaus fand ich in einem Robotikforum die Anregung, nach dem Vorbild alter Dampflokomotiven eine „Kuhschürze“ zu bauen – damit räumten die Stahlrösser alle Hindernisse von den Schienen. Diese Karosserieverlängerung zum Boden hin würde dann neben verirrten Igeln auch Äpfel und Föhrenzapfen schonend aus dem Weg schaffen, was meiner Faulheit sehr entgegenkäme.
Das Lochblech habe ich schon daheim. Die Unaussprechliche verdreht bereits die Augen und hat die Nummer der Rettung auf den Tisch geklebt. Wie meist, wenn ich Anstalten mache heimzuwerken.
Was fehlt
(aus: Ö1-GEHÖRT, Juli 2021)
Wenn Sie einen Blick in meinen Keller werfen könnten, würden Sie wahrscheinlich auf der Stelle psychologische Betreuung brauchen (nein, keine eingesperrten Menschen!). Wie schon öfters erwähnt, habe ich zu Gerümpel, das mir noch brauchbar erscheint, eine pathologische Beziehung. Es soll aber auch Menschen geben, die sich jeden Müll auf das Handy laden. Kollegin Ulla hat kürzlich eine Rangliste von Apps erstellt, die man definitiv NICHT braucht: Da wäre zum Beispiel der Biersimulator. Wenn man das Handy ansetzt, leert sich die Biermenge am Bildschirm. Ebenso sinnbefreit ist der Kuss-Test am Smartphone. Man muss seine Lippen auf den Monitor drücken und wird von der Maschine bewertet. Ulla hat – nach eigenen Angaben – diesen Intimakt mit dem Mikrobenzirkus am Handy verweigert (aber alle Apps schlummern noch auf ihrem Smartphone wie ein Herpesvirus). Am ekelhaftesten war die Pickel-App … aber das erspare ich Ihnen jetzt.
 Die Liebste stand jüngst mit ihrem Kaffeehäferl völlig verzweifelt vor dem Kühlschrank, weil die Milch aus war. In Homeoffice-Zeiten ist das ein systemrelevantes Infrastrukturversagen. Die Kaffeemaschine muss derzeit im 90-Minuten-Rhythmus Arbeits- und Lebensenergie liefern. „Wo ist jetzt der Kühlschrank, von dem sie uns seit 25 Jahren erzählen, dass er selbst die Milch nachbestellt?“, polterte die Unaussprechliche und fluchte in gut verständlichem Oberösterreichisch über die irrelevante Technologieentwicklung der letzten Dekaden. Da ich Milch nicht vertrage, übte ich mich in vorgetäuschter Empathie, wie sie Beziehungen guttut. Aber es überwiegt der Eindruck, dass sehr viele Erfindungen ein Problem lösen, das erst durch die Erfindung entsteht. Oder wollten Sie jemals eine Kussbewertung oder ein virtuelles Bier?
Die Liebste stand jüngst mit ihrem Kaffeehäferl völlig verzweifelt vor dem Kühlschrank, weil die Milch aus war. In Homeoffice-Zeiten ist das ein systemrelevantes Infrastrukturversagen. Die Kaffeemaschine muss derzeit im 90-Minuten-Rhythmus Arbeits- und Lebensenergie liefern. „Wo ist jetzt der Kühlschrank, von dem sie uns seit 25 Jahren erzählen, dass er selbst die Milch nachbestellt?“, polterte die Unaussprechliche und fluchte in gut verständlichem Oberösterreichisch über die irrelevante Technologieentwicklung der letzten Dekaden. Da ich Milch nicht vertrage, übte ich mich in vorgetäuschter Empathie, wie sie Beziehungen guttut. Aber es überwiegt der Eindruck, dass sehr viele Erfindungen ein Problem lösen, das erst durch die Erfindung entsteht. Oder wollten Sie jemals eine Kussbewertung oder ein virtuelles Bier?
Der smarte Kühlschrank jedenfalls gehört zu den großen Leitversprechen des Internets der Dinge. Zwar gibt es schon Waschmaschinen, die das Reinigungsmittel selbst nachbestellen, ebenso wie einen sensorverstärkten Hundenapf für das automatische Ordern der Hundekekse, aber das Intelligenteste, was man Kühlschränken angedeihen ließ, sind Kameras. Damit man im Supermarkt nachschauen kann, was noch drin ist… Wenn das so bleibt, werden die Liebste und ich weiterhin das Smarteste sein, was unsere Küche zu bieten hat.
Handyqual
(aus: Ö1-GEHÖRT, Juni 2021)
Man zwang mich zum Handykauf. Der Druck kam aus der Maschine selbst und von der Familie. Das langjährige Smartphone blockierte nach und nach alle Updates, weil es zu wenig Speicher im Gerät fand. Ich reduzierte mich also immer mehr auf das Telefonieren und ein paar wenige Apps wie das praktische E-Banking. Schließlich verweigerte mir die Hosentaschenmaschine auch die Erfüllung meiner digitalen Grundbedürfnisse.
 Die Buben drängten zu einem Neukauf, weil sie mein Herumgetue mit dem Gerät schlicht und einfach würdelos fanden, #Fridaysforfuture hin oder her. Her musste ein neues Smartphone. Aber nichts macht mich so kraftlos wie die Aussicht, in der Unmenge der Angebote einen neuen Minicomputer auswählen zu müssen. Mich befiel ein sogenannter Komolka – ein bestimmt häufiges, aber im offiziellen Katalog der Krankheiten noch nicht dokumentiertes „instantanes Erschöpfungssyndrom“. Ich hatte es zum ersten Mal erlebt, als ich mit einer Vorgängerin der Liebsten ein opulentes, gleichnamiges Stoffgeschäft besuchte und beim Anblick der 1000en Stoffballen ermattet niedersank.
Die Buben drängten zu einem Neukauf, weil sie mein Herumgetue mit dem Gerät schlicht und einfach würdelos fanden, #Fridaysforfuture hin oder her. Her musste ein neues Smartphone. Aber nichts macht mich so kraftlos wie die Aussicht, in der Unmenge der Angebote einen neuen Minicomputer auswählen zu müssen. Mich befiel ein sogenannter Komolka – ein bestimmt häufiges, aber im offiziellen Katalog der Krankheiten noch nicht dokumentiertes „instantanes Erschöpfungssyndrom“. Ich hatte es zum ersten Mal erlebt, als ich mit einer Vorgängerin der Liebsten ein opulentes, gleichnamiges Stoffgeschäft besuchte und beim Anblick der 1000en Stoffballen ermattet niedersank.
Als ich den Buben kundtat, sie sollten mir ein Smartphone aussuchen und ihnen auf Nachfrage ein 250Euro-Budget dafür nannte, wollten sie sich selbst zur Adoption freigeben.
Es wurde also teurer.
Seitdem ruft mich niemand mehr an. Oder vielmehr: Ich höre keine Anrufe mehr, weil mir der Klingelton noch immer so fremd ist. Und wenn ich wissentlich angerufen werde, weiß ich in der Eile nicht, wie ich grad wischen muss, um abzuheben. Da hilft mir auch unser Putzroboter nicht. Außerdem hat sich das Handy selbst zusammengeräumt, weil es viele Apps nicht übersiedelte. Als subklinischer Messie weiß ich diese Selbstaufräumfunktion mehr als zu schätzen.
Dafür habe ich eine wunderbare neue App namens BirdNET entdeckt. Sie belauscht den Gesang der Vögel und sagt mir, wer gerade sein Lied zwitschert. Kohlmeise und Buchfink kenne ich mittlerweile ohne Hilfe künstlicher Intelligenz. Die Liebste schaut mich meist etwas zweifelnd an, wenn ich der fliegenden Fauna lausche, und nennt die App nur Vogel-Shazam*. Wobei insgesamt der Rest der Familie endgültig der Ansicht ist, ich hätte einen nämlichen.
Okay, wird Zeit, dass ich wieder mehr unter Leute komme.
*Die App Shazam erkennt den Titel von Liedern durch Zuhören
Klima-Digitalisierung
(aus: Ö1-GEHÖRT, Mai 2021)
So wie viele Männer leide auch ich unter einer chronischen Krankheit, dem Automatisierungswahn. In seiner leichtesten Ausprägung geht es dabei nur um das Licht, das im Heizraum automatisch angeht; in einer aggressiveren Variante messe ich die Luftfeuchtigkeit im Wohnzimmer, um dann im Büro zu sehen, dass gelüftet werden müsste. Vom Bodensensor im Hochbeet will ich gar nicht reden. Ich wage allerdings zu bezweifeln, ob deswegen 1 Radieschen besser gewachsen ist.
 Mit umso mehr Argwohn sehe ich jetzt, dass einige glauben, auch die Klimakrise weg-automatisieren zu können. Die Bitkom, der Interessensverband der deutschen IT-Industrie, rechnete jüngst vor, man könne mit Hilfe der Digitalisierung jede fünfte Tonne CO2 einsparen. Mit Big Data lassen sich etwa Produktionsstätten viel besser überwachen und dadurch besser auslasten, was energieintensive Leerläufe verhindert. Digitale Zwillinge, also virtualisierte Industrieanlagen, werden es möglich machen, neue Verfahren ohne Ressourceneinsatz im Computer zu testen.
Mit umso mehr Argwohn sehe ich jetzt, dass einige glauben, auch die Klimakrise weg-automatisieren zu können. Die Bitkom, der Interessensverband der deutschen IT-Industrie, rechnete jüngst vor, man könne mit Hilfe der Digitalisierung jede fünfte Tonne CO2 einsparen. Mit Big Data lassen sich etwa Produktionsstätten viel besser überwachen und dadurch besser auslasten, was energieintensive Leerläufe verhindert. Digitale Zwillinge, also virtualisierte Industrieanlagen, werden es möglich machen, neue Verfahren ohne Ressourceneinsatz im Computer zu testen.
Gesundheits-Apps und digitale Medizinprodukte reduzieren Fahrten zum Arzt, so die Bitkom, auch die elektronische Patientenakte vermeidet tausende Tonnen Kohlendioxid, ebenso wie das Homeoffice. Das Arbeiten von daheim aus könne ebenso wie die intelligente Gebäudesteuerung auch in Österreich den CO2-Verbrauch bis 2030 um einige Megatonnen reduzieren. Selbst in der Landwirtschaft ist vieles möglich: Messen etwa Sensoren den Nährstoffbedarf im Boden, lässt sich viel gezielter düngen. Da liegt das Einsparungspotenzial von Klimagasen laut Bitkom bei 16%.
Werkzeuge wie diese können uns sicher dabei helfen, die Erderwärmung zu bremsen. Alleinseligmachend ist aber auch die Digitalisierung nicht. Wollen wir etwa eine Landwirtschaft, in der sich nur die Großbauern die teuren Optimierungsmaschinen leisten können und damit die kleinen Landwirte eliminieren? Oder wollen wir die technische Verwaltung unserer Häuser irgendwelchen Monopolen überlassen? Bevor wir uns einer automatisierten Zukunft anvertrauen, gibt es noch viel zu überdenken.
Große, zentralistische Lösungen richten üblicherweise viel mehr Schaden an als meine selbstgebastelten Automaten, die wenigstens meine Buben (aus Mitleid) zum Lachen bringen.
Paralleluniversen
(aus: Ö1-GEHÖRT, April 2021)
„Was schaust du denn für eine Nerdkacke*?“, fragte der Große kürzlich. Es war einer der raren Momente, in denen ich vor dem Fernseher saß und Alfred Brendel beim Rezitieren seiner skurrilen Notizen zuhörte. Nun ist Brendel wohl wirklich nicht teenagertauglich, aber es schien, als wäre ich für meinen Sohn in ein Paralleluniversum ausgewandert. Als dann auch noch Kurzstücke von György Kurtag erklangen, wollte der Große schon die europäische Notfallnummer wählen.
 Ich rief ihm noch nach, dass ich nicht nur Schubert, sondern auch Rammstein und Frank Ocean mag. Letzteres besänftigte den Großen ein wenig. Wir hatten eine kleine Schnittmenge gefunden. Erst da fiel mir auf, wie weit unsere Medienwelten auseinanderklaffen. Hier die Unaussprechliche und ich, die das ORF-Sendeschema internalisiert haben, egal ob jenes im TV oder in Ö1, dort die zwei Buben, die Medieninhalte nur mehr auf Abruf kennen. Der Teenie bezieht ebenso wie seine Freunde den Großteil seiner Informationen über Instagram (was für ein Glück, dass wir dort als öffentlich-rechtlicher Medienbetrieb präsent sein dürfen). Schnittlauchlocke (er ist drei Jahre jünger) erfährt alles, was er glaubt, wissen zu müssen, über TikTok – selbst Rezepte für eine 5-Minuten-Pizza.
Ich rief ihm noch nach, dass ich nicht nur Schubert, sondern auch Rammstein und Frank Ocean mag. Letzteres besänftigte den Großen ein wenig. Wir hatten eine kleine Schnittmenge gefunden. Erst da fiel mir auf, wie weit unsere Medienwelten auseinanderklaffen. Hier die Unaussprechliche und ich, die das ORF-Sendeschema internalisiert haben, egal ob jenes im TV oder in Ö1, dort die zwei Buben, die Medieninhalte nur mehr auf Abruf kennen. Der Teenie bezieht ebenso wie seine Freunde den Großteil seiner Informationen über Instagram (was für ein Glück, dass wir dort als öffentlich-rechtlicher Medienbetrieb präsent sein dürfen). Schnittlauchlocke (er ist drei Jahre jünger) erfährt alles, was er glaubt, wissen zu müssen, über TikTok – selbst Rezepte für eine 5-Minuten-Pizza.
So gesehen gäbe es für jeden von uns beim anderen Nerdkacke zu finden (danke, Großer, für dieses wunderbare Wort). Diese Fragmentierung macht es uns auch gesellschaftlich zunehmend schwer. Die verbindliche Erzählung, der wir früher beim abendlichen Lagerfeuer namens TV lauschten, ist uns abhandengekommen, wie schon vielfach beklagt. Die Paralleluniversen, in die sich Menschen zurückziehen, nennt man heute Bubbles. Es sind jene Blasen, in denen sich jeder seine eigene Wirklichkeit zimmern kann, ohne Rücksicht nehmen zu müssen auf Fakten oder Spielregeln, wie sie etwa die Wissenschaft liefert. Entsprechend schwierig wird dann mangels gemeinsamer Basis auch die Diskussion. Davon lebt allerdings die Demokratie. Zu einer gemeinsamen Basis zurückzufinden und die Bubbles zu kommunizierenden Gefäßen zu machen (dazu müssten die klickorientierten Plattformen ihre Spielregeln ändern), wird für ein friedliches Zusammenleben entscheidend sein. Sonst ersticken wir in Nerdkacke.
*Nerds sind Menschen mit besonderen Interessen und sozialen Defiziten…
Robi und seine Freunde
(aus: Ö1-GEHÖRT, März 2021)
Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich behaupten: Corona hat die Fortpflanzungsrate unter Staubsaugerrobotern erheblich gesteigert. In meinem Umfeld vermehren sie sich gerade rasant. Und alle bekommen sie Namen. Kollegin Julia nennt ihren majestätisch Karl-Ludwig und schickt Videos von seiner Arbeit (nach food-porn jetzt also floor cleaning-porn als neuer Trend?). Stefan nennt seinen automatischen Sauger sehr prosaisch Sklave; man muss ihm seine poesielose Benamsung nachsehen, er ist Techniker.
 Beim IT-Experten Peter heißt er Anna, „wie die polnische Putzfrau“ seiner Eltern. Wie ich bei einer Umfrage überhaupt lernen musste, dass Menschen auch den absonderlichsten Geräten Namen geben. Prometheus als Rufname für eine Heißluftfritteuse ist schon sehr speziell, ebenso wie Brutus für einen Herd (da würde ich den Messerblock weit wegstellen). Manchmal entwickeln sich ganze Genealogien: „Mein Staubsaugerroboter heißt Staubjohann, weil der Mähroboter meines Vaters Johann heißt“, schreibt mir Elke. Und bei Irene heißen überhaupt alle Geräte Franz, „weil der Chef so heißt“ und offenbar endlich mal was arbeiten soll.
Beim IT-Experten Peter heißt er Anna, „wie die polnische Putzfrau“ seiner Eltern. Wie ich bei einer Umfrage überhaupt lernen musste, dass Menschen auch den absonderlichsten Geräten Namen geben. Prometheus als Rufname für eine Heißluftfritteuse ist schon sehr speziell, ebenso wie Brutus für einen Herd (da würde ich den Messerblock weit wegstellen). Manchmal entwickeln sich ganze Genealogien: „Mein Staubsaugerroboter heißt Staubjohann, weil der Mähroboter meines Vaters Johann heißt“, schreibt mir Elke. Und bei Irene heißen überhaupt alle Geräte Franz, „weil der Chef so heißt“ und offenbar endlich mal was arbeiten soll.
Vielleicht haben auch die zahlreichen Lockdowns dazu beigetragen, dass Menschen jetzt vermehrt mit ihren Maschinen reden. Nachdem der humane Kontakt seit einem Jahr stark eingeschränkt ist, begnügen wir uns auch mit dem Technikpark als Konversationspartner. „Anthropomorphismus“ nennt die Wissenschaft den Hang, Geräte zu vermenschlichen. Entsprechend werden die elektronischen Helferleins auch gelobt, wenn sie tun, was sie sollen („Brav, Robi“!), oder mit Kosenamen bedacht, um sie günstig zu stimmen („Staubi, Waschi, Spüli“, wie Ruth sagt), und andererseits mit übelsten Schimpfwörtern bedacht, wenn sie renitent sind.
Auch bei uns daheim hat das verstärkte Homeoffice zu einer Lurch-Invasion geführt. Hier übernimmt ein humanoides Modell namens Franz das Staubsaugen. Er ist seiner Meinung nach pflegeleicht, vergisst manchmal unter dem Bett zu saugen und lädt sich nachts in horizontaler Lage auf.
Jetzt will die Unaussprechliche ein verlässlicheres elektronisches Modell. Es ist mir auch wurscht, wenn der Lurchschlucker dann wieder Franz heißt.
Klagen über Klagen
(aus: Ö1-GEHÖRT, Februar 2021)
Das Leben macht momentan nur kleine Schritte. Eine Weile führten sie überhaupt nur bis zur Gartentür. In der biedermeierlichen Gefangenschaft zwischen Idyll und Dystopie vergesse ich manchmal, dass sich draußen ein virtuelles Paralleluniversum befindet – die Welt der Amazons und der anderen, die die Pandemie im Gegensatz zu uns noch stärker gemacht hat. Die Politik kommt jetzt quer über den Globus zur Einsicht, dass die Giganten ob ihrer weltumspannenden Macht demokratiezersetzend sein könnten.
 Der Online-Riese ist nicht nur Versandhändler, er ist auch Verkaufsplattform für viele kleine Betriebe. Darum weiß er über die Preisentwicklung jeglicher Produkte Bescheid. Er kann in die Verkaufsbücher der Händler blicken und alle Daten auswerten. Entsprechend passt er die Preise seines eigenen Angebots an. Die EU-Kommission hat vor kurzem mit einer Kartellklage gegen Amazon auf diesen desaströsen Wettbewerbsvorteil durch Datensammeln reagiert.
Der Online-Riese ist nicht nur Versandhändler, er ist auch Verkaufsplattform für viele kleine Betriebe. Darum weiß er über die Preisentwicklung jeglicher Produkte Bescheid. Er kann in die Verkaufsbücher der Händler blicken und alle Daten auswerten. Entsprechend passt er die Preise seines eigenen Angebots an. Die EU-Kommission hat vor kurzem mit einer Kartellklage gegen Amazon auf diesen desaströsen Wettbewerbsvorteil durch Datensammeln reagiert.
Selbst der US-Administration wurde Googles Dominanz nun zuviel. Texas und neun andere Bundesstaaten haben die Google-Tochter Alphabet verklagt, weil die Suchmaschine ihr Quasi-Monopol ausnutzt und keinen freien Wettbewerb mehr zulässt. Dabei ist dies nur eine von mehreren Klagen, denen sich Google gegen Ende des Jahres in den liberalen USA stellen musste.
Facebook wiederum sieht sich Klagen von 48 Bundesstaaten samt US-Bundeshandelskommission gegenüber. Es hat mit dem Kauf der Fotoplattform Instagram und des Messenger- und Nachrichtendienstes WhatsApp ebenfalls ein Monopol geschaffen. Und es macht auf diesen Plattformen Meinung, weltumspannend. Weil obskure Verschwörungstheorien „klickfreundlich“ sind – das Geschäftsmodell des Datenhändlers Facebook, werden sie natürlich von den intransparenten Algorithmen nach wie vor bevorzugt. Was manche selbst an der Kugelform der Erde zweifeln lässt. Daran kann auch Marc Zuckerbergs Lieblingsphrase Marc Zuckerbergs, „I am sorry“, nichts ändern.
Über die zahlreichen Sprachassistenten wie Siri oder Cortana steuert eine Handvoll Netz-Goliaths nicht nur unsere Einkäufe und unsere Meinungen, sondern auch unsere Häuser und Wohnungen. So viel Macht in der Hand so weniger tut uns nicht gut. Ich glaube, ich werde Alexa in Rente schicken.
Verwahrlost und verzweifelt
(aus: Ö1-GEHÖRT, Jänner 2021)
2020 hat unsere Familie etwas verwahrlosen lassen. Wir 4 sitzen in 4 Räumen vor 4 Computern und tippen auf 4 Tastaturen ein. Aufgrund unterschiedlicher Online-Termine in Homeschooling- und Homeoffice sehen wir uns bis zum Abend nur auf dem Weg zum Kühlschrank. Manchmal schickt mir die Liebste ein Kuss-Smiley durch die Wand, das in etwa so viele Kilometer durch Glasfaserleitungen zurücklegt, wie wir in diesem Jahr gerne gereist wären. Und wenn sie manchmal fragt „Wo sind die Buben?“, antworte ich: „im Internet“.
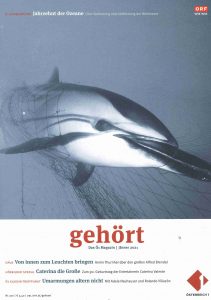 Schlimmer kann die Ortslosigkeit in diesen Zeiten nicht mehr werden.
Schlimmer kann die Ortslosigkeit in diesen Zeiten nicht mehr werden.
Nach 30 Tagen Quarantäne hatten wir noch 1 Tag, bis wir uns in den Lockdown begaben. Und wenn es kein merkbares physisches Lebensumfeld mehr gibt, weil wir seit 1. Oktober kaum mehr jemanden in 3D sehen, dann verschwindet auch der Raum, in dem man sich gerade aufhält.
„Heute Nacht bist du aber spät heimgekommen“, sagte die Unaussprechliche – ohne Tadel – vor ein paar Tagen. In „Wirklichkeit“ saß ich mit dem Gitschtaler Freund Uli bis nach Mitternacht virtuell zusammen – verbunden über eine Datenleitung und einen Notebook-Monitor. Mein „Heimweg“ bis zur Schlafzimmertür war nicht länger als 5 Meter. Uli und ich ließen uns sogar hinreißen, die Hände am Bildschirm aneinander zu drücken, was in unserer Männerfreundschaft eine körperliche Sensation ist.
Wo unser Leben dabei ist, in eine ortslose Teleexistenz abzudriften, wird uns das Physische und Analoge klarerweise wieder viel wichtiger. Möglicherweise bleibt von diesem ungewollten Feldexperiment mit Virus und Virtualität tatsächlich etwas zurück, was unser Leben in den nächsten Monaten besser macht: sei es die Konzentration auf weniger und enge Freunde, statt dem Herumgehetze zwischen vielen Schauplätzen und Bekannten, oder sei es der gezieltere Einsatz von Technologie, den wir jetzt gezwungenermaßen bis weit hinter das Lebenswerte ausgedehnt haben.
Bald wird es vielleicht Luxus sein, NICHT auf Bildschirme starren zu müssen oder KEINE VR-Brille nötig zu haben. Oder wie es ein Bekannter schon vor 20 Jahren ausdrückte: Wenn du es wirklich geschafft hast, brauchst du kein Handy mehr.