Im Dezember, anlässlich der 300. Ausgabe von Ö1-Gehört, hat Bibiane Zeller-Presenhuber, in der Kolumne die „Unaussprechliche“, auf meine Kolumnen reagiert 🙂 Und so gehörte Kolumne #80 der Liebsten:
Entgegnung
(aus: Ö1-GEHÖRT, Dezember 2020)
 Seit zwei Wochen haben wir eine zweite Alexa im Haus. Und das obwohl ich nicht einmal den ersten sprechenden Lautsprecher offiziell genehmigt habe. Sie wundern sich jetzt über diese Wortwahl? Überraschung! Hier schreibt nicht wie üblich der Digital-Gemahl, sondern dessen Frau – hier besser bekannt als „die Unaussprechliche“.
Seit zwei Wochen haben wir eine zweite Alexa im Haus. Und das obwohl ich nicht einmal den ersten sprechenden Lautsprecher offiziell genehmigt habe. Sie wundern sich jetzt über diese Wortwahl? Überraschung! Hier schreibt nicht wie üblich der Digital-Gemahl, sondern dessen Frau – hier besser bekannt als „die Unaussprechliche“.
Nach dem Kauf unserer ersten Alexa wurde jetzt ihre Schwester in elegantem Weiß geliefert. Sie darf im Badezimmer wohnen. Angeblich brauchen wir sie, um mit den Kindern im Untergeschoss kommunizieren zu können. Die jedoch ignorieren die Aufforderung via Alexa zum „Handy abschalten“ oder zum „Essen kommen“ nicht weniger, als wenn wir mit unserer eigenen Stimme durch das Haus brüllen. Jetzt habe ich mir gedacht, wenn das Teil nur irgendwie Sinn machen soll, dann muss ich diese Fehlinvestition für mich persönlich nutzen. Seither sortiere ich penibel das Online-Angebot sämtlicher Schuhläden. Die Webseiten lasse ich am Computer absichtlich geöffnet, um dem Liebsten etwas Angst einzuflößen. Bestellt habe ich bislang noch keinen einzigen Treter. Bitte verraten Sie das nicht meinem Mann. Den Schweiß auf seiner Stirn angesichts diverser Modelle mit roten Sohlen oder scheußlichem Leopardenmuster möchte ich gern noch etwas länger genießen.
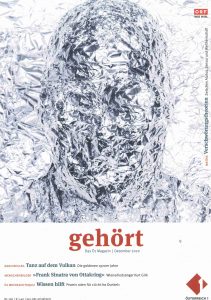 Wissen Sie eigentlich, dass mein Mann ein Messie ist? Er sammelt angefangen von Schrauben in allen Größen über ausrangierte Geräte und Ladekabel bis zu Accessoires aus diversen Urlauben einfach alles. Wenn er sich von einem einzigen Teil trennt, kommen tags darauf mindestens zwei Pakete eines Online-Anbieters, der in unserem Haushalt vom Nachwuchs zum „No-Go“ deklariert wurde.
Wissen Sie eigentlich, dass mein Mann ein Messie ist? Er sammelt angefangen von Schrauben in allen Größen über ausrangierte Geräte und Ladekabel bis zu Accessoires aus diversen Urlauben einfach alles. Wenn er sich von einem einzigen Teil trennt, kommen tags darauf mindestens zwei Pakete eines Online-Anbieters, der in unserem Haushalt vom Nachwuchs zum „No-Go“ deklariert wurde.
Ganz schlimm ist sein Faible für elektronische Geräte. Als ich kürzlich meinem Chef erklärte, dass wir neben einem Sous-Vide-Gerät zum Garen von Fleisch, zwei 3D-Druckern, drei Drohnen und zwei Vakuumier-Geräten auch einen Mäh-Roboter besitzen, meinte er „Da fehlt noch der Laubsauger für den herbstlichen Blätterwald“. Tja, den haben wir selbstverständlich auch.
Ich aber werde mich jetzt dem neuen weißen Lautsprecher anvertrauen. „Alexa, bitte bestelle alles aus meinem aktuellen Warenkorb.“ Und nein, da ist nicht das drin, was sie glauben!
Vertrauenskrise
(aus: Ö1-GEHÖRT, November 2020)
„Gar nicht lustig!“ Also sprach der Große, als er noch sehr klein war und ihm 3-Wort-Sätze ausreichten, um uns zu kritisieren. Seine Worte gingen mir kürzlich beim Aufwachen durch den Kopf. Ich dachte darüber nach, dass ich die Stopp Corona-App noch immer nicht installiert hatte. Und dass es keinen Grund für diese Verweigerung gibt. Selbst Max Schrems, bekannt für seine besondere Sensibilität in allen Fragen der Datenweitergabe, hatte die App so wie Hacker oder die Informatik an der Uni Wien auf Herz und Nieren geprüft und für gut und tauglich befunden.
 Einerseits laden wir uns Apps privater, gewinnorientierter Unternehmen auf unsere Smartphones, die quasi permanent heimtelefonieren, sodass E.T. vor Neid erbleichen würde ob der glühenden Leitungen. Andererseits begegnen wir einem Programm, das unter wesentlicher Mitarbeit eines demokratischen Staates und mit einem hehren Ziel entstanden ist, mit so großem Misstrauen. Das ist unverhältnismäßig.
Einerseits laden wir uns Apps privater, gewinnorientierter Unternehmen auf unsere Smartphones, die quasi permanent heimtelefonieren, sodass E.T. vor Neid erbleichen würde ob der glühenden Leitungen. Andererseits begegnen wir einem Programm, das unter wesentlicher Mitarbeit eines demokratischen Staates und mit einem hehren Ziel entstanden ist, mit so großem Misstrauen. Das ist unverhältnismäßig.
Mehr als die Hälfte aller Apps auf Ihrem Smartphone nimmt mit dem Datenhändler Facebook Kontakt auf, egal, ob Sie zugestimmt haben oder nicht. Und diese kleinen Spione geben unter anderem Ihre Werbe-ID weiter, sodass sich ein hervorragendes Datenprofil zu Ihrer Person erstellen lässt. Sie werden damit Teil einer Verhaltensökonomie, in der man die Daten aus einem Periodentracker am Handy genauso auswertet wie man anhand Ihrer Bibel-App Schlüsse auf Ihren Wertekanon zieht. Und dazu müssen Sie nicht einmal einen Dienst aus dem Facebook-Imperium, egal ob WhatsApp oder Instagram, nutzen. Ähnlich neugierig ist übrigens Google, aus dessen Hause das populärste mobile Betriebssystem Android ja stammt.
Wie gelinde nimmt sich im Vergleich dazu ein Programm aus, das wie im Fall der Stopp Corona-App die Kontakte pseudonymisiert und lokal am Smartphone abspeichert. Nur weil einzelne Akteure im Staat sich vor Untersuchungsausschüssen oder vor Gericht als moralisch sehr elastisch outen, darf man nicht unsere demokratische Kraft in Frage stellen. Darum lade ich die Corona-App jetzt herunter.
PS: „Gar nicht lustig!“ finden die Buben auch die neuen Schuhe, die mir die Unaussprechliche gekauft hat. Sie haben mit dem Jugendamt gedroht, wenn ich sie in ihrer Anwesenheit anziehe. Jetzt gehen die Liebste und ich wieder öfter zu zweit essen.
Bits und Bytes für die Küche
(aus: Ö1-GEHÖRT, Oktober 2020)
„Wir sind so eine verfressene Familie“, sprach der Große einst, als er noch kleiner war und Dinge so sagte, wie er sie meinte. Wir sind aber auch eine küchenbesessene Familie. Selbst Schnittlauchlocke (11) kocht seit einiger Zeit. Sein Kochbuch: die Teenie-App TikTok, mit deren Hilfe er zuerst einmal eine 5-Minuten-Tassenpizza in der Mikrowelle zubereitete. Sein Vater hyperventilierte kurz ob des Rezepts, schluckte jeglichen Kommentar hinunter und verlieh sich selbst einen Preis für Selbstbeherrschung… Der Hintergedanke: „Das ist der kulinarische Einstieg. Bald kocht er ohne Mikrowelle.“
 Ich hatte Recht. Zuletzt richtete Schnittlauchlocke eine Art Weizenfladen an (wieder mit TikTok). Da der Kleine Teflon überschätzt, gern Öl verweigert und auch die Herdplatte notorisch abzudrehen vergisst, sieht unsere Palatschinkenpfanne nun aus wie eine Reliefversion des deutschen Mittelgebirges. Aber Hauptsache, mein Sohn spürt das kulinarische Feuer.
Ich hatte Recht. Zuletzt richtete Schnittlauchlocke eine Art Weizenfladen an (wieder mit TikTok). Da der Kleine Teflon überschätzt, gern Öl verweigert und auch die Herdplatte notorisch abzudrehen vergisst, sieht unsere Palatschinkenpfanne nun aus wie eine Reliefversion des deutschen Mittelgebirges. Aber Hauptsache, mein Sohn spürt das kulinarische Feuer.
Auch mich selbst hat das Internet in Sachen Küche verändert. Ähnlich wie im Garten sind die Ressorts nach Jahren der Küchenschlacht auch dort zwischen mir und der Unaussprechlichen aufgeteilt: Ich verantworte Braten und Brot, die Zubereitung von Fischen und Salaten, die Liebste kümmert sich um Wild, Curries und Eintöpfe. Letztere wurden mir mit Mehrheitsbeschluss verboten.
Neuerdings bereite ich auch schnelle Kuchen zu, deren Rezepte ich durch Vergleiche aus dem Netz beziehe. Unsere 80 wunderbaren Kochbücher in Ehren, aber für die schnelle Küche gibt es nichts Besseres als ein Online-Rezept, das zudem schon hunderte Male getestet wurde. Profiköche haben ja die Tendenz, ihre Leser/innen immer wieder mal ein bissl hinters Licht zu führen. Aber Kochbücher haben für mich ohnehin nur mehr inspirierenden Charakter. Ich mag die Küche der Verzweiflung: man kocht einfach mit dem, was da ist. Und das geht am besten, wenn man schon ein wenig kochen kann. Oder man nutzt eine der vielen Restlverwertungs-Apps und -Webseiten als Küchenhilfe. Schließlich sind die Haushalte für mehr als die Hälfte aller verschwendeten Lebensmittel verantwortlich.
Zuletzt hat Schnittlauchlocke einen 5-Minuten-Kuchen nach TikTok „gebacken“. Jetzt können wir auch die Mikrowelle wegwerfen.
Robo-Sex für Veilchen
(aus: Ö1-GEHÖRT, September 2020)
Nach einer kurzen Phase der Eskalation ist unser Garten jetzt Waffenstillstandszone. Wir haben ihn nämlich funktionell und personell zweigeteilt: die Unaussprechliche ist für das Schöne, also die Blumen und Stauden zuständig, ich für das Essbare (und den Rasenmäherroboter, der aber aus Tierschutzgründen nur 2 Stunden am Tag herumstreunen darf). Ich verschone die Tigerschnegel, obwohl sie entgegen den Behauptungen der Unaussprechlichen Salat, Basilikum und Petersilie auf Putz und Stingel fressen.
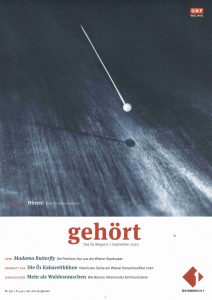 Dafür respektiert die Frau meines Herzens ab nun meine Nützlinge, allen voran den blattlausfressenden Ohrwurm, obwohl ihr vor dem kleinen Viech graut. Über Anregung eines gartenbesessenen Freundes bin ich nämlich völlig ins Insektophile gekippt. Seitdem weiß ich, wie brav sich Florfliegen und Schlupfwespen um den Garten kümmern, und dass nicht nur die 80 Milliarden Honigbienen weltweit am Werk der Bestäubung mitarbeiten, sondern den überwältigenden Großteil der pflanzlichen Sexarbeit Mauer- und Sandbienen, Gnitzen oder auf den ersten Blick gar nicht sympathische Käfer verrichten.
Dafür respektiert die Frau meines Herzens ab nun meine Nützlinge, allen voran den blattlausfressenden Ohrwurm, obwohl ihr vor dem kleinen Viech graut. Über Anregung eines gartenbesessenen Freundes bin ich nämlich völlig ins Insektophile gekippt. Seitdem weiß ich, wie brav sich Florfliegen und Schlupfwespen um den Garten kümmern, und dass nicht nur die 80 Milliarden Honigbienen weltweit am Werk der Bestäubung mitarbeiten, sondern den überwältigenden Großteil der pflanzlichen Sexarbeit Mauer- und Sandbienen, Gnitzen oder auf den ersten Blick gar nicht sympathische Käfer verrichten.
Umso überraschter war ich, als ich über diese Umwege im Juli auf ein Zukunftsprojekt stieß, das die menschliche Einfalt auf einer Länge von 1 Zentimeter zusammenfasst: Roboter-Bienen.
Universitäten und Firmen weltweit, allen voran in den USA, China und den Niederlanden, arbeiten an Mini-Drohnen, die in Zukunft die Arbeit der Bestäubung übernehmen sollen. Nachdem die Neonicotinoide in den letzten Jahren alles dezimiert haben, was sechs Beine hat, rüsten wir jetzt technisch auf und wollen fliegenden Sondermüll jenes Werk erledigen lassen, das die Natur bisher zum Nulltarif zum Nutzen aller erbrachte. Auch wenn es vorderhand nur Fiktion ist: Aber es ist offenbar denkbar, dass in einem Vierteljahrhundert ein weltumspannender Datenkonzern namens BEEgle die Bestäubungslogistik der Bonsai-Drohnen übernimmt und die Menschheit in Sachen Ernährung völlig von ihm abhängt.
Ich übe mich vorderhand trotzdem in Optimismus und hege und pflege die Sechsbeiner in unserem Garten. Das Giftmassaker im Weizenfeld am gegenüberliegenden Hang kann ich damit zwar nicht verhindern. Aber der einzige Roboter im Garten bleibt bis auf Weiteres der Mähautomat.
Lange Leitung
(aus: Ö1-GEHÖRT, August 2020)
Modeaffine Menschen mögen nach diesem ersten Satz zu lesen aufhören. Oder gleich zum zweiten Absatz springen, denn: Jüngst lieferte die Post ein Paket, dem die Unaussprechliche Dinge für mich entnahm, die ich nie bestellt hatte. Mit liebevoller Hinterhältigkeit hatte sie einen Pullover und ein Hemd geordert. „Sonst würdest du noch immer mit dem weißen Pullover herumlaufen, in dem ich dich vor 17 Jahren kennengelernt hatte“, sagte sie nur und nötigte mich zur Anprobe. Auch deshalb mag ich online shoppen bzw. shoppen lassen: weil ich mir die elende Zeit in deprimierenden Modehallen erspare (danke, Liebste). Und weil ich fast nur Hosen einer Marke trage, gibt es auch keine Retouren. Und dass diese Art konzentrierten Einkaufs ökologisch besser ist als eine Autoreise ins Einkaufszentrum, darauf habe ich schon im November mit Zahlen hingewiesen.
 Auch eine andere Art von Online-Lieferung ist weitaus besser als ihr Ruf, wenn man es vernünftig angeht: das Streaming, also das Schauen von Videos über das Netz. Bewegtbild macht immerhin fast dreiviertel des weltweiten Datenverkehrs aus! Betrachtet man Videos mit SD-Auflösung auf einem Smartphone, Tablet oder Notebook, verschlingt das weniger Energie als klassisches Fernsehen oder das Abspielen einer DVD auf einem großen TV-Gerät. Das hat die deutsche Bitkom jetzt in einer umfangreichen Untersuchung gezeigt. Und selbst wenn man eine Stunde feinaufgelöstes HD schaut, dann entspricht das klimatechnisch einer 1-Kilometerfahrt mit einem durchschnittlichen PKW. Je mehr Daten über die Leitung rutschen müssen, wie bei 4K-Videodaten, umso mehr Energie brauchen die Kommunikationsnetze und die Rechenzentren. Und schon verpestet man die Welt mit dem Äquivalent einer 10-Kilometerfahrt.
Auch eine andere Art von Online-Lieferung ist weitaus besser als ihr Ruf, wenn man es vernünftig angeht: das Streaming, also das Schauen von Videos über das Netz. Bewegtbild macht immerhin fast dreiviertel des weltweiten Datenverkehrs aus! Betrachtet man Videos mit SD-Auflösung auf einem Smartphone, Tablet oder Notebook, verschlingt das weniger Energie als klassisches Fernsehen oder das Abspielen einer DVD auf einem großen TV-Gerät. Das hat die deutsche Bitkom jetzt in einer umfangreichen Untersuchung gezeigt. Und selbst wenn man eine Stunde feinaufgelöstes HD schaut, dann entspricht das klimatechnisch einer 1-Kilometerfahrt mit einem durchschnittlichen PKW. Je mehr Daten über die Leitung rutschen müssen, wie bei 4K-Videodaten, umso mehr Energie brauchen die Kommunikationsnetze und die Rechenzentren. Und schon verpestet man die Welt mit dem Äquivalent einer 10-Kilometerfahrt.
Weltweit schlägt sich der Trend zum Video trotzdem recht satt nieder: Wir brauchen immerhin 1% der Primärenergie für Netze, Rechner und Endgeräte. Andererseits wird die Übertragung immer energieeffizienter, innerhalb von 2 Jahren um ein beeindruckendes Viertel.
Videos lasse ich mir übrigens nicht von der Unaussprechlichen „liefern“. Da zehre ich eher vom Know How vom Großen und von Schnittlauchlocke. Nach drei Folgen einer Serie fadisiere ich mich glücklicherweise oft. Und gehe dann Radiohören.
Nichts als die Wahrheit!
(aus: Ö1-GEHÖRT, Juli 2020)
Es ist Zeit für ein neues Hobby, dachte ich mir nach 8 Wochen des Lockdowns. Ich werde jetzt ein Anhänger von Verschwurbelungstheorien. Ich riss der Lachsforelle am Grill die Alufolie vom Leib und bastelte mir einen Aluhut. „Es sind ja gar keine Flugzeuge am Himmel“, sagte Schnittlauchlocke und tippte sich an die Stirn, „außerdem riechst du wie ein toter Fisch.“ „Es ist wegen five tschi“, sagte ich, „bei unserem Telekomanbieter sitzt ein bankrotter Tiroler Seilbahnbetreiber und hustet in ein Mikrofon. Hier fliegen die Viren dann aus dem Mobilfunkmasten. Deswegen der Aluhut. Steht bestimmt auch auf Facebook.“
 „Typischer Papawitz“, sagte der Große und tippte sich ebenfalls an die Stirn. In Sachen Wertschätzung drückt das Wort „Papawitz“ ungefähr so viel aus wie die Totenköpfe, die die Buben auf meine liebevoll gekochten Eintöpfe malen, wenn sie sie einfrieren, um sie im ewigen Eis verschwinden zu lassen.
„Typischer Papawitz“, sagte der Große und tippte sich ebenfalls an die Stirn. In Sachen Wertschätzung drückt das Wort „Papawitz“ ungefähr so viel aus wie die Totenköpfe, die die Buben auf meine liebevoll gekochten Eintöpfe malen, wenn sie sie einfrieren, um sie im ewigen Eis verschwinden zu lassen.
Dem Kleinen verbat ich daraufhin, Windows zu benutzen. Gates verbreitet seine in einer Garage gezüchteten Viren ja sicher auch über das Betriebssystem. Und dem Großen schlug ich vor, wir sollten eine Kräutermischung gegen Corona trinken, am besten Ingwer und Zitrone. „Zu spät“, sagte der Große, „diese Idee hatte schon Tansanias Präsident. Mit mehr Erfolg als du.“
Da hörte ich, wie Schnittlauchlocke seinem Bruder etwas zuflüsterte. „Papa hat immer alle Impfungen gemacht. Du weißt ja, was da passiert. Ich habe mir immer eine Schwester gewünscht, aber nie eine bekommen. Ich habe auf YouTube gesehen, warum: weil die Impfungen ihn stabil gemacht haben.“ „Steril“, korrigierte der Große und seufzte.
„Alles Blödsinn“, mischte sich daraufhin die Unaussprechliche ein. „Wir hätten euren Vater Anfang März wegen seiner Allergie nicht zum Arzt schicken sollen. Die haben ihm dort unter Vollnarkose einen Chip eingesetzt. Das machen sie jetzt mit allen Europäern. Voll geheim. Mit furchtbaren Nebenwirkungen, wie man sieht.“
„Wenn das solche Folgen hat, möchte ich den Chip nicht“, sagte Schnittlauchlocke und flüchtete mit dem Großen ins Trampolin. „Super“, murmelte die Unaussprechliche, als die Kinder weg waren. „Die Lachsforelle hätte eh nicht für uns alle gereicht.“
Neue Nähe
(aus: Ö1-GEHÖRT, Juni 2020)
„Durch den Abstand sind wir zusammengewachsen.“ Also sinnierte Nachbarin Edith beim ersten distanzierten Zusammentreffen nach der Corona-Abstinenz über ihre Beziehung. Eine vergleichbare Entwicklung gab es auch in unserem Haus: Der Große und Schnittlauchlocke sind seit dem Social Distancing viel enger als zuvor. Wobei ich überhaupt nach diesem Wust an Digital-Kommunikation, an Videokonferenzen, beruflichen wie privaten Chat-Gruppen und Mail-Orgien an eine neue Phase der Nähe, des Haptischen und Analogen glaube. Nach dem Crash-Test digital könnte vielleicht vor allem das bleiben, was wir wirklich brauchen, nicht jene Ablenkungen, deren vermeintliche Notwendigkeit wir uns einreden lassen. Die Videopartys mit unseren Freunden im fernen Gitschtal werden bleiben, weil die Distanz bleibt. Aber jetzt haben wir gelernt, wie man sie würdevoll überwindet. Barbara, Michi und all die anderen werden wir wieder ohne verschwommene Monitorbilder herzen. Hier waren die Videos Notlösungen.
 Die Buben sehnen sich schon sehr nach Lehrkräften, mit denen sie von Angesicht zu Angesicht reden können. (Manche haben sich nicht einmal per Video gemeldet und stattdessen nur Grammatiktafeln rübergeschoben. Was über das Selbstverständnis der betroffenen Lehrenden genauso viel aussagt wie über die Notwendigkeit ansprechbarer PädagogInnen statt Computerlehre!)
Die Buben sehnen sich schon sehr nach Lehrkräften, mit denen sie von Angesicht zu Angesicht reden können. (Manche haben sich nicht einmal per Video gemeldet und stattdessen nur Grammatiktafeln rübergeschoben. Was über das Selbstverständnis der betroffenen Lehrenden genauso viel aussagt wie über die Notwendigkeit ansprechbarer PädagogInnen statt Computerlehre!)
Ansonsten haben wir uns gegen die Verrohung im Homeoffice weitgehend erfolgreich gewehrt. Die Unaussprechliche zieht noch immer eine Hose an, obwohl man sie in ihren zig Videokonferenzen ohnehin nur bis zur Tischkante sieht. (Schuhtechnisch dürfte sie aber in der Isolation irgendeinen Knacks abbekommen haben. Sie hat sich erst 1 Paar Schuhe bestellt, und das sind Laufschuhe.) Schnittlauchlocke zieht seinen Pyjama spätestens aus, wenn er mit den Hausübungen fertig ist, meist so gegen 15.00 Uhr. Ich habe die Hygiene auch noch nicht ganz aufgegeben, obwohl Homeoffice laut dem Kabarettisten Klaus Eckel „Arbeiten ohne Zähneputzen“ ist. Und der Große trägt tagelang eine Jogginghose, für die er uns vor Corona noch bei der Jugendwohlfahrt angezeigt hätte, hätten wir sie ihm auch nur vorgeschlagen.
Einzig der Netzwerkdrucker im Haus verweigert sich in regelmäßigen Abständen. Aber selbst mit dieser Launenhaftigkeit kommen wir neuerdings gut zurecht. Wir akzeptieren die Unverlässlichkeit von Technik endlich.
14040
(aus: Ö1-GEHÖRT, Mai 2020)
Es war bei einem Mittagessen vor Corona-Zeiten, als die Kantine noch offen war und sich Monika outete. „Ich hätte so gern einen Einsvierzigvierzig daheim“, meinte sie schwärmerisch und seufzte nach allen Regeln der Schmachtkunst. 14040 – das ist unsere Helpline für Computerprobleme aller Art. Dort sitzen Menschen, die immer freundlich sind und sich den Tag über wohl die absurdesten Computerprobleme anhören müssen, aber trotzdem nie die Contenance verlieren. Wen wundert es, dass Monika all ihre Sehnsüchte nach Hilfe und Verständnis auf die Männer der Helpline projizierte.
Jetzt, mitten in der Corona-Zeit, hätten wir wohl alle gern so ein(en) 14040 – „ein höheres Wesen, das uns leitet“, wie der Herr Karl sinngemäß schon vor mehr als einem halben Jahrhundert sagte.
Ich für meinen Teil brauche 14040 nicht für metaphysische Spitzfindigkeiten, sondern für den ganz banalen Alltag. 14040 möge mir zum Beispiel erklären, warum in unserem Hausnetz mit flottem 200 Mbit-Anschluss über WhatsApp keine Videoanrufe möglich sind. Schnittlauchlocke schaltet immer das Mobilnetz ein und braucht teures extra Datenvolumen, um die Hausübungen mit seinem Freund abzusprechen. Die Teamarbeit dauert im Übrigen stundenlang.
Schnittlauchlocke ist auch Generation iPad. Er versteht also gar nix von Computern. Was dazu geführt hat, dass er am 2. Tag des Home-Schooling ein 12seitiges Dokument Seite für Seite ausgedruckt hat, nichtwissend, dass danach das ganze Dokument 12mal aus dem Drucker kam. Das ergibt nicht nur eine Quadratzahl von Zetteln, sondern auch viele leere Tintenpatronen. Mittlerweile kann der Kleine immerhin Mails mit Dateianhängen schicken. Ich bin mir allerdings nach den Erfahrungen der letzten Wochen nicht mehr sicher, ob alle Lehrer/innen in der Lage sind, sie zu öffnen oder dafür auch ein kundiges 14040 brauchen.
Ich bräuchte – neben viel Gelassenheit – auch ein großes gütiges 14040, das mir erklärt, warum die Lernplattformen für Bürokraten und Monks gemacht sind und nicht für Kinder, warum es gefühlte 17 davon gibt, von denen 60 Prozent dauerhaft nicht funktionieren, und warum PädagogInnen im Regelfall nicht in der Lage sind, Videokonferenzen abzuhalten.
Großes 14040, hilf!
Ausgebremst!
(aus: Ö1-GEHÖRT, April 2020)
Mich überrascht im Straßenverkehr nur mehr selten etwas. Schließlich ist der Mensch, wenn er von Blech umgeben ist, so bei sich, dass er alle Grauslichkeiten rauslässt, die er sonst glücklicherweise in seinem Inneren hütet. Aber jüngst war es unser Auto, das mich überraschte. Es legte ohne mein Zutun eine Vollbremsung hin. Höhnisch schrieb es mir dann auf’s Display, ein automatisches City Safety Dings habe für mich gebremst. Ich neige nicht zur Schreckhaftigkeit, aber da schoss mir das Adrenalin schon kurz bis in die Ohrläppchen.
Nun fühlt sich der Mann an sich ja nicht dazu berufen, Gebrauchsanleitungen zu lesen. Schon gar keine für ein Auto. Ich wollte dann aber doch wissen, ob ich – und wenn ja: in welchem Fall – mit weiteren Verhaltensauffälligkeiten meines Wagens zu rechnen habe. Jetzt weiß ich zumindest, dass sich die Karre offenbar irgendwelche autonomen Entscheidungen vorbehält, wenn ich sie nicht auf dem siebten Untermenü im Bordcomputer deaktiviere. (Wir haben den Wagen vor 8 Monaten gebraucht gekauft. Deshalb hat uns auch kein eifriger Autohändler wortreich die Finessen der Karre beschrieben.)
Nachdem ich ja schon vor einiger Zeit aufgehört habe, meine Notebooks und Computer mehr als nötig zu konfigurieren, kam ich erst recht nicht auf die Idee, die Blechschüssel einzurichten, wie man das bei Produkten der Computerindustrie nennt. Das war selbstverständlich naiv. Man muss heutzutage alles einrichten, von der elektrischen Zahnbürste über das WLAN bis zum automatischen Espresso-Brüher.
Fußballfreund Peter, von dem ich schon mal erzählte, traf die Mikroprozessorverseuchung seines Wagens ebenfalls auf dem falschen Fuß: Irgendwas lief schief beim Update, und plötzlich blieben alle Displays im Luxus-Elektromobil finster. Als er hernach in eine Tiefgarage einfuhr, erkannte ihn sein Auto nicht mehr und der Hersteller musste es abschleppen.
Bei Kollegin Julia gab das Leihauto selbständig Gas. (Ihr Partner am Steuer schwor Stein und Bein, nicht an der Geschwindigkeitsattacke schuld gewesen zu sein.)
Wahrscheinlich waren die Autos einfach nur schlecht eingerichtet oder falsch upgedated.
Ich lese jetzt mal konzentriert die Gebrauchsanleitung unseres Wagens. Was für eine Demütigung.
Robotertraining
(aus: Ö1-GEHÖRT, März 2020)
Manchmal sagt die Unaussprechliche ganz schlimme Wörter zu Alexa. Ich möchte sie hier gar nicht wiederholen, da sie mit oberösterreichischer Wucht daherkommen und nicht zitabel sind, aber in jedem Fall den Zweck haben, die Sprachassistentin zum Schweigen zu bringen. Alexa ist des Öfteren auch wirklich schwer von Begriff. Selten kann man mit ihr so reden, wie man das mit einem Menschen tun würde. Das arrogante Ding lernt wenig von uns und zwingt uns im Gegenteil seine Sprache auf, wenn wir ihm Aufträge geben.
 Das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine ist fragil. Zunehmend öfter scheint es, als würden wir Verhalten und Gestus der Maschinen übernehmen, statt sie mit unserer Moral zu füttern. Ein drastisches Beispiel hörte ich unlängst über Umwege aus Japan, das ja punkto Roboterbegeisterung kaum zu überbieten ist. Immer mehr Männer scheinen dort zu vereinsamen, weil sie vorwiegend Umgang mit Maschinen wie Siri und Alexa haben und deshalb die eigenen Wände nicht mehr verlassen. Die digitalen Dienerinnen bestellen ihnen Essen oder erzählen ihnen Witze, sie lesen ihnen auch Gute Nacht-Geschichten vor. Es gibt also wenig Anreiz, sich ins physische Leben zu stürzen, zumal der genuine Roboter-Verehrer von klein auf lieber mit Tamagotchis und anderen Mediensystemen hantiert, als mal mit dem Nachbarsbuben zu raufen.
Das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine ist fragil. Zunehmend öfter scheint es, als würden wir Verhalten und Gestus der Maschinen übernehmen, statt sie mit unserer Moral zu füttern. Ein drastisches Beispiel hörte ich unlängst über Umwege aus Japan, das ja punkto Roboterbegeisterung kaum zu überbieten ist. Immer mehr Männer scheinen dort zu vereinsamen, weil sie vorwiegend Umgang mit Maschinen wie Siri und Alexa haben und deshalb die eigenen Wände nicht mehr verlassen. Die digitalen Dienerinnen bestellen ihnen Essen oder erzählen ihnen Witze, sie lesen ihnen auch Gute Nacht-Geschichten vor. Es gibt also wenig Anreiz, sich ins physische Leben zu stürzen, zumal der genuine Roboter-Verehrer von klein auf lieber mit Tamagotchis und anderen Mediensystemen hantiert, als mal mit dem Nachbarsbuben zu raufen.
Verhaltensoriginelle Forscher aus Japan hatten nun die Idee, die Männer zum Kommunikationstraining zu schicken – und zwar zu humanoiden Robotern. In ihrer emotionalen Spannweite sehr beschränkte Automaten sollen Menschen also menschliches Verhalten beibringen – wir sprechen hier von Flirttraining mit einer Blechdose als Lehrer.
Geht’s noch? Ich zumindest kenne keinen Menschen, der jemanden einkochen kann, nur weil er eine Küchenmaschine daheim hat. Aber so ähnlich stellen sich die Anti-Einsamkeits-Trainer das in ihren maschinellen Allmachtsphantasien vor.
Möglicherweise ist das japanische Projekt auch nur eine Riesen-PR-Aktion für Sexroboter, denn die wären konsequenterweise die richtigen Partner für die einsamen Herzen vor ihren Monitoren. Abgesehen davon sind die Folgen von Lehr-Maschinen für unsere Empathiefähigkeit noch gar nicht absehbar.
Und jetzt erzähl mir einen Roboterwitz, Alexa! Damit ich mich beruhige.
Mein TV, meine Buben und ich
(aus: Ö1-GEHÖRT, Februar 2020)
Ich bin verzweifelt. Meine Familie gibt in ideenarmen Zeiten auch nichts mehr her. Seit seiner Gehirnerschütterung ist der Große einfach nur lieb. Schnittlauchlocke ist altersgemäß mit seinem Handy verwachsen, aber ab und zu kann ich es ihm aus der Hand operieren. Und auch die Unaussprechliche ist mit dem Leben und ihrem Schuhkasten völlig im Reinen.
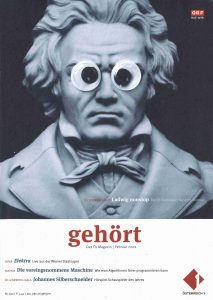 Glücklicherweise entzündete sich jüngst eine Diskussion vor dem Fernsehgerät. (Zur Erklärung: Weihnachten war heuer so entspannend, dass ich ins Unproduktive kippte und meine Jahres-TV-Zeit mit Filmen wie „Drei Haselnüsse für Aschenputtel“ oder „Avatar II“ innerhalb weniger Tage verdoppelte. Schön war’s!) Der Große mokierte sich bei einem Familienfilm also über die mangelnde Auflösung des Fernsehgeräts. Da ich froh bin, wenn ich die Glotze mit freiem Auge sehe, machte ich mir über Details wie die Anzahl der Pixel am Schirm bisher wenig Gedanken. Ob meiner technologischen Ignoranz redete sich mein Bub in Rage. Am Ende des Abends war klar, dass wir drauf und dran sind, den technologischen Anschluss völlig zu verlieren und in die Pixelarmut abgleiten.
Glücklicherweise entzündete sich jüngst eine Diskussion vor dem Fernsehgerät. (Zur Erklärung: Weihnachten war heuer so entspannend, dass ich ins Unproduktive kippte und meine Jahres-TV-Zeit mit Filmen wie „Drei Haselnüsse für Aschenputtel“ oder „Avatar II“ innerhalb weniger Tage verdoppelte. Schön war’s!) Der Große mokierte sich bei einem Familienfilm also über die mangelnde Auflösung des Fernsehgeräts. Da ich froh bin, wenn ich die Glotze mit freiem Auge sehe, machte ich mir über Details wie die Anzahl der Pixel am Schirm bisher wenig Gedanken. Ob meiner technologischen Ignoranz redete sich mein Bub in Rage. Am Ende des Abends war klar, dass wir drauf und dran sind, den technologischen Anschluss völlig zu verlieren und in die Pixelarmut abgleiten.
Nachdem uns die Buben in Sachen Umweltbewusstsein längst auf Schiene gebracht haben, verlaufen die generationellen Gräben bei uns jetzt offenbar entlang von Hi-Tech-Fragen. (Danke Buben, dass ihr mir die derzeit grassierenden dümmlichen Grabenkämpfe zwischen Jung und Alt ansonsten erspart!)
Alle Welt jenseits meiner Wahrnehmung spricht laut dem Großen von 4k und 8k, das bedeutet wahlweise 8 Millionen oder 32 Millionen Bildpunkte am TV.
Nur, ich will alles gar nicht so genau sehen. Ich wurde fernsehmäßig mit Biene Maja und Wicki sozialisiert. Die Figuren bestanden aus gefühlten vier Farben und 12 Bildpunkten von der Größe einer Walnuss. Darf ich das bitte weiterhin so halten?! Mich machen diese Hochglanzfilme buchstäblich verrückt. Ich will ihrer Geschwindigkeit nach einem meist rasanten Alltag nicht mehr folgen. Und dass die Bilder ob ihrer Brillanz manchmal fast steril auf mich wirken, möchte ich auch erwähnen.
Abgesehen davon, Großer: du schaust eh nur mehr in Ausnahmefällen fern und ziehst dir Videos meist über Notebook und Handy rein, auf Bildschirmen so groß wie ein Volksschulheft. Für die paar wenigen Stunden am TV werden unsere 8 Millionen Bildpunkte wohl reichen.
Müllo-Mania
(aus: Ö1-GEHÖRT, Jänner 2020)
Weihnachten stürzt mich jedes Jahr in eine Müllspirale. Natürlich beginnt es ganz physisch mit den vielen Kartons in und vor der roten Tonne. Aber es gibt ja auch so viel Digitalmüll. Auf meinem Handy drängen sich die Weihnachtswünsche in Form von kollabierenden Weihnachtsmännern und brennenden Kerzen – als Foto, Animation und Comic. Weiter geht es dann mit den Neujahrswünschen in Form von Feuerwerken – als Foto, Animation und Comic. Manchmal lasse ich alles im Handy überleben, bis sein Speicher kollabiert und ich in einem Aufwaschen alles lösche bzw. löschen muss. Ein Wunder, dass das Smartphone ob all der feuerlichen (sic!) Wünsche nicht zu brennen beginnt.
 Apropos brennen: im Keller habe ich einen Karton mit alten Handys entdeckt, einige davon echte Relikte der 90er-Jahre. „Und wo ist da das Internet?“, hat Schnittlauchlocke angesichts der Minidisplays gefragt. Gut, er würde andererseits auch ein Telefon mit Wählscheibe nicht als solches erkennen. Wie mir die Abfalllobby fast wöchentlich mitteilt, sind die alten Handys brandgefährlich, wegen der darin verbauten Lithium-Batterien. Die neigen dazu, hin und wieder in Flammen aufzugehen. Wenn das nun mal die Frau erfährt, die ich in dieser Kolumne bis auf Widerruf nicht mehr erwähnen darf und die deshalb vorläufig „die Unaussprechliche“ heißen wird… Dann wird die Unaussprechliche mich zwingen, ein Dutzend Ö3-Wundertüten damit vollzustopfen und nix wird es damit, die alten Dinger 2030 um eine Million zu versteigern…
Apropos brennen: im Keller habe ich einen Karton mit alten Handys entdeckt, einige davon echte Relikte der 90er-Jahre. „Und wo ist da das Internet?“, hat Schnittlauchlocke angesichts der Minidisplays gefragt. Gut, er würde andererseits auch ein Telefon mit Wählscheibe nicht als solches erkennen. Wie mir die Abfalllobby fast wöchentlich mitteilt, sind die alten Handys brandgefährlich, wegen der darin verbauten Lithium-Batterien. Die neigen dazu, hin und wieder in Flammen aufzugehen. Wenn das nun mal die Frau erfährt, die ich in dieser Kolumne bis auf Widerruf nicht mehr erwähnen darf und die deshalb vorläufig „die Unaussprechliche“ heißen wird… Dann wird die Unaussprechliche mich zwingen, ein Dutzend Ö3-Wundertüten damit vollzustopfen und nix wird es damit, die alten Dinger 2030 um eine Million zu versteigern…
(Die Unaussprechliche hat sich als Reaktion auf Kolumne 65 im September übrigens wirklich ein halbes Dutzend Schuhe gekauft und dafür annähernd sechs Paar entsorgt. So sollte ich eigentlich auch die Zahl meiner digitalen und elektronischen Güter stabil halten.)
Ja, eh: Ich neige zum Nicht-Entsorgen. Weil man ja all die defekten Geräte irgendwann einmal als Ersatzteile brauchen könnte, den defekten Stabmixer, die Fernsteuerung des kaputten Brio-Zugs, die marode Funkklingel oder die tote Zeitschaltuhr. Sie alle fristen ein Dasein in der ewigen Warteschlange, im Keller, in einer annähernd waschmaschinengroßen Schachtel oberhalb der Handybox.
Wenn das nun mal die Unaussprechliche erfährt. Na prack…
Wunschzeit
(aus: Ö1-GEHÖRT, Dezember 2019)
„Das Einkommen der Kinder richtet sich nach dem Einkommen des Vaters… na dann, Papa, hopp-hopp!“ Also sprach der 10jährige kürzlich, während er einen Zeitungsartikel über soziale Ungleichheit las. Dies hat mich auf verqueren Wegen zu dieser Kolumne mit drei Wünschen für das analoge wie digitale Leben gebracht.
 Da im Österreich des Jahres 2019 Aufstiegschancen – siehe Schnittlauchlocke – noch immer ähnlich festgeschrieben sind wie im Ständestaat, wünsche ich mir, dass Bildung und Einkommen ab sofort nicht mehr „erblich“ sind. Eine gesunde Gesellschaft braucht die Gehirne von allen Menschen und kann es sich aus vielerlei Gründen nicht leisten, allzu viele durch Nichtbeachtung zu demütigen und zurück zu lassen. So wie es Pädagogenkommissionen schon in den 70er Jahren vorgeschlagen haben, müssen wir Kinder nicht mit 10 in Schulzweige selektieren, wenn wir darauf vertrauen, dass Bildung etwas bewirken kann. Man braucht keine Glaskugel, um zu prophezeien, dass neue digitale Werkzeuge wie Künstliche Intelligenz oder auch nur die Einordnung von Nachrichten in Sozialen Medien Kompetenzen braucht, die über das Lenken eines Mopeds hinausgehen.
Da im Österreich des Jahres 2019 Aufstiegschancen – siehe Schnittlauchlocke – noch immer ähnlich festgeschrieben sind wie im Ständestaat, wünsche ich mir, dass Bildung und Einkommen ab sofort nicht mehr „erblich“ sind. Eine gesunde Gesellschaft braucht die Gehirne von allen Menschen und kann es sich aus vielerlei Gründen nicht leisten, allzu viele durch Nichtbeachtung zu demütigen und zurück zu lassen. So wie es Pädagogenkommissionen schon in den 70er Jahren vorgeschlagen haben, müssen wir Kinder nicht mit 10 in Schulzweige selektieren, wenn wir darauf vertrauen, dass Bildung etwas bewirken kann. Man braucht keine Glaskugel, um zu prophezeien, dass neue digitale Werkzeuge wie Künstliche Intelligenz oder auch nur die Einordnung von Nachrichten in Sozialen Medien Kompetenzen braucht, die über das Lenken eines Mopeds hinausgehen.
Kürzlich klagte Freund Paul darüber, dass seine Studierenden nur mehr furchtbare Zukunftsvisionen vor Augen haben, veritable Dystopien über den Untergang des Abendlandes unter Silicon Valleyscher Technokratur. Aber ihnen fehle jegliche positive Utopie, wie wir die Welt zum Positiven gestalten könnten. Genau das braucht eine Gesellschaft jedoch, um nicht in passiver Depression zu verharren. Also predige ich: Habet den Mut zu positiven Vorstellungen von der Zukunft. (Und so viel sei verraten: Ö1 wird dem im Lauf des nächsten Jahres Zeit widmen.)
Und noch etwas ganz Persönliches, was mich kürzlich auf der Makerfaire in Rom, der Präsentationsbühne für Macher, mehr als irritierte und fast zornig machte: Da ging man an Ständen mit Menschen vorbei, die in der Mehrzahl nur in ihre Smartphones starrten, statt den Besucherinnen ihre wunderbaren Ideen nahezubringen. Das war spooky. So leget das Teufelszeug auch mal weg – und ganz ehrlich: Daheim stecken wir bereits mitten in einem digitalen Diätprogramm. Alle. Damit Schnittlauchlocke öfter die Zeitung liest, als nur dann, wenn er mehr Einkommen vom Papa fordert.
Kaputt
(aus: Ö1-GEHÖRT, November 2019)
Wolfi, ein Vertrauter aus Salzburger Zeiten, antwortete auf die erste Digitalisierungswelle im Büro (90er Jahre) mit schlechten Vibes. Er hasste das neue Schnittprogramm für Radiobeiträge. Wenn er hinter mir vorbei ging, stürzte das System ab. Wir trafen uns daraufhin vorwiegend im Wirtshaus.
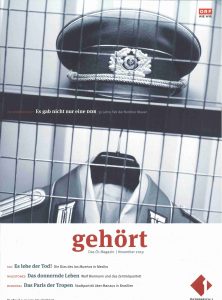 Daheim gibt es eine Dame, deren Namen ich vorläufig in der Kolumne nicht mehr erwähnen darf. Jüngst ging unter ihren Händen das Notebook ein, zuvor hatte sie eine kleine Küchenmaschine ruiniert, und ein paar Monate zuvor köpfelten zwei Smartphones kurz hintereinander in technosuizidaler Absicht auf den Betonboden. Ich gab ihr wiederholt den Namen „Gerätetod“. Sie antwortete mit zwei Wörtern: dem Vor- und Nachnamen einer prominenten Scheidungsanwältin. Seither vermeide ich beim weiblichen Teil der Familie jegliche Anspielungen auf den saumäßigen Umgang mit Ressourcen.
Daheim gibt es eine Dame, deren Namen ich vorläufig in der Kolumne nicht mehr erwähnen darf. Jüngst ging unter ihren Händen das Notebook ein, zuvor hatte sie eine kleine Küchenmaschine ruiniert, und ein paar Monate zuvor köpfelten zwei Smartphones kurz hintereinander in technosuizidaler Absicht auf den Betonboden. Ich gab ihr wiederholt den Namen „Gerätetod“. Sie antwortete mit zwei Wörtern: dem Vor- und Nachnamen einer prominenten Scheidungsanwältin. Seither vermeide ich beim weiblichen Teil der Familie jegliche Anspielungen auf den saumäßigen Umgang mit Ressourcen.
Abseits dieser familiären Verwerfungen haben wir ein ganz generelles Problem. Wunderdinge wie Smartphones lassen sich kaum mehr reparieren. Weil die Erzeuger das auch nicht wollen. Wenn Sie einmal ein beschädigtes iPhone öffnen, werfen Sie zuerst die Nerven, danach das Gerät weg. Mit großen ökologischen Kosten: Die größten klimarelevanten CO2-Emissionen, rund dreiviertel davon, entstehen bei der Herstellung. So hat die Smartphone-Produktion laut Greenpeace zw. 2007 und 2017 den Energie-Jahresbedarf von Indien verschlungen. (Nachdem wir Smartphones im Schnitt alle 20 Monate austauschen, selbst wenn sie funktionieren, würde es dem Klima auch schon helfen, sie länger zu nutzen.)
Reparieren ist bei hohen Arbeitskosten wie in Österreich darüber hinaus teuer. Schweden steuert der Ressourcenverschwendung längst entgegen. Es verrechnet auf Reparaturen keine Mehrwertsteuer. Die EU will nun Hersteller zwingen, ihre Geräte – nicht nur Handys – reparaturfähig zu bauen. Schließlich stecken in einem Smartphone rund 60, zum Teil sehr wertvolle Elemente, und viele der ausgedienten Telefone landen in einem Schrank und werden vergessen.
Wer wie ich als Heimwerker gefürchtet ist, der kann auch Reparaturcafés nützen. Dort werden, quer durch das Land, kaputte Kaffeemaschinen oder marode Föne vielfach mit einfachsten Mitteln in Stand gesetzt. Oft fehlt es nur an einem Bauteil, das ein paar Cent kostet.
Gutes CO2-Karma ist Ihnen damit auf jeden Fall sicher.
Online-Shopping-Schelte
(aus: Ö1-GEHÖRT, Oktober 2019)
Jüngst verfiel ich in eine unschöne Einkaufswut. In Folge tröpfelten ein paar Tage später circa 5 Pakete ein. Ich hatte ja bequem online bestellt. Dies nutzten meine #fridaysforfuture-Buben, um mich kräftig zu schimpfen. Von wegen CO2-Abdruck und Nachhaltigkeit und Karton-Tohuwabohu.
 Schuldbewusst nahm ich die Schelte entgegen und gelobte mich zu bessern. Dann klopfte aber der Wissenschaftsjournalist in mir an die Schädeldecke und verlangte nach Fakten.
Schuldbewusst nahm ich die Schelte entgegen und gelobte mich zu bessern. Dann klopfte aber der Wissenschaftsjournalist in mir an die Schädeldecke und verlangte nach Fakten.
Zu meiner eigenen Überraschung ist Online-Shopping nicht a priori amoralisch, wenn man die Erde nicht weiter aufheizen will. Ein Paar Schuhe verursacht bei der Zustellung ein halbes Kilogramm CO2-Emissionen. Damit kommt man mit einem Mittelklassewagen knapp drei Kilometer weit. Lokal einkaufen rentiert sich nach Meinung des Deutschen Ökologie-Instituts klimatechnisch dann, wenn das Geschäft nicht weiter als 900 Meter entfernt liegt.
Aber das ist noch kein Freispruch für den elektronischen Fernhandel. Zum einen werden nicht nur relativ kleine Schuhkartons versandt, sondern auch große Einrichtungsgegenstände oder Fernseher. Zum anderen werden zwei von drei Schuhen zurückgeschickt, bei Kleidung rechnet man mit einer Retourenquote von 50 Prozent. Und jetzt ist die nette Klimabilanz dahin.
Online-Shoppen ist also nur dann günstiger, wenn man genau weiß, was man braucht, wenn die Ware standardmäßig verschickt wird und der Zusteller die Lieferadresse nicht mehrfach anfahren muss.
Noch gar nicht geredet haben wir davon, dass jede zweite Online-Bestellung den amerikanischen Superkonzern Amazon noch reicher und tendenziell zum Monopol macht. Außerdem muss er nicht nach hierzulande geltenden Regeln spielen. Während österreichische Händler für die Entsorgung der Verpackungsmaterialien einen Beitrag zahlen müssen, blechen wir für die Entsorgung von Kartonagen aus dem Ausland selber. Eine umfassendere Bilanz des Online-Shoppens ist also durchaus zwiespältig.
Immerhin konnte ich mich argumentativ bei meinen Buben rehabilitieren. Schnittlauchlocke, ein fanatischer Kicker, bestellte sich personalisierte Fußballschuhe im Netz (geht nur dort). Als ich die Versandbestätigung bekam, musste ich ein bissl grinsen: Sie kam aus Ho-Chi-Minh.
Unsere neue Frau
(aus: Ö1-GEHÖRT, September 2019)
„Ihr sollt keine anderen Göttinnen haben neben mir!“ Also hätte die Liebste gesprochen, wäre sie etwas bibelfester. Stattdessen sagte sie nur: „Mir kommt keine andere Frau ins Haus!“ Damit meinte sie unter anderem, aber vor allem Alexa. Alexa ist zum Synonym für Sprachsteuerung aus dem Hause eines Online-Riesen geworden. Das Gerät in Form eines Lautsprechers lässt sich über Sprachbefehle steuern und spricht mit weiblicher Stimme zurück. Sie erzählt Witze und spielt etwa auf Wunsch auch das Programm von Ö1 ab.
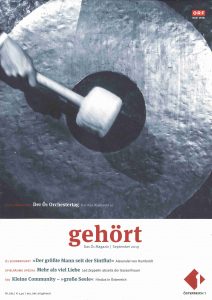 Das Verbot erteilte die Frau meines Vertrauens vor mehr als zwei Jahren. Deshalb setzte ich auf ihre Vergesslichkeit und bestellte Alexa vor einem Monat um den Preis eines Bio-Huhns. Ich argumentierte, ich müsse wissen, worüber ich in meiner digitalen Welt berichte. Die Liebste zog ein Schnoferl und bestellte postwendend ein gefühltes halbes Dutzend Schuhe um den Preis eines E-Bikes.
Das Verbot erteilte die Frau meines Vertrauens vor mehr als zwei Jahren. Deshalb setzte ich auf ihre Vergesslichkeit und bestellte Alexa vor einem Monat um den Preis eines Bio-Huhns. Ich argumentierte, ich müsse wissen, worüber ich in meiner digitalen Welt berichte. Die Liebste zog ein Schnoferl und bestellte postwendend ein gefühltes halbes Dutzend Schuhe um den Preis eines E-Bikes.
Jetzt spielt Alexa die Wunschlieder meiner Kinder oder erzählt ihnen Witze. Ich rede recht einsilbig mit ihr und sage meist nur, „Alexa, leiser!“, oder „Alexa, stopp!“. Noch öfter ziehe ich den Stecker, weil Alexa ziemlich neugierig ist und immer zuhört, was wir in der Wohnküche so reden.
Interessanterweise sprechen die meisten Sprachassistenzsysteme, auch Cortana oder Siri, mit Frauenstimme. Das hat jetzt zu einer gut begründeten Kritik von Seiten der UNO geführt. Alexa und ihre Kolleginnen sind hilfsbereit, geduldig und vor allem unterwürfig. Da man ihnen stimmlich ein weibliches Geschlecht gibt, verstärken sie so noch Geschlechterklischees. Schließlich erzeugt Sprache Wirklichkeit. Manche Institutionen experimentieren deshalb schon mit geschlechtsneutralen künstlichen Stimmen für Maschinen.
Die aktuelle Schieflage in Sachen Robotergeschlecht kommt wohl auch daher, dass nur 12% der Beschäftigten in der IT Frauen sind. Oder wie der „Österreichische Rat für Robotik“ kürzlich auf Twitter sinngemäß postete: Wenn in Zukunft Roboter den Lauf der Welt mitbestimmen, sollten sie nicht nur von Männern programmiert werden.
In der Zwischenzeit lernen wir den Buben kochen, waschen und gärtnern. Damit sie niemals auf Alexas angewiesen sind, egal, ob diese Maschinen mit weiblicher oder männlicher Stimme sprechen.
Pony-Fetisch
(aus: Ö1-GEHÖRT, August 2019)
Es kommt nicht mehr oft vor. Aber manchmal verblüffen mich Dinge im Netz schon noch.
Jüngst war ich mit meinen drei Brüdern auf einer kroatischen Insel. Wir hatten kein Programm, weil alle sehr erschöpft waren. Wir wollten einfach die gemeinsame Zeit mit ansonsten zwecklosen Verrichtungen feiern. Da trabte ein Pony an uns vorbei. Das erinnerte Christian und Robert an eine Szene, die sie im Netz gesehen hatten. Flugs zog einer das Smartphone aus der Tasche und startete YouTube.
 Im folgenden Video trafen sich Menschen bei einem Festival in den Südstaaten, um sich als Ponys zu verkleiden und vor einen Sulky spannen zu lassen. Darin saß zumeist eine Reiterin. Hurtig und glücklich hüpfte das Pseudo-Rösslein vor seinem Gefährt her, immer wieder wohlwollend angetrieben von der steuernden Dame, die ihre sekundären Geschlechtsmerkmale mit einem opulenten Kostüm in Schwarz und Rot betont hatte. Das menschliche Pony wiederum trug sein Zaumzeug im Mund, als wäre der Knebel im Maul das Selbstverständlichste auf der Welt. Und es wurde mit seiner ungewöhnlichen Neigung durchaus nicht allein gelassen. Seine Wege kreuzten sich mit einem Pferdchen, das so wie die Evolution es geschaffen hatte unbekleidet durch den Park trabte. Dann wiederum mühte sich ein Latex-Pony sichtlich dabei ab, einer überdimensionalen Reiterin mit seiner Zugkraft zu gefallen.
Im folgenden Video trafen sich Menschen bei einem Festival in den Südstaaten, um sich als Ponys zu verkleiden und vor einen Sulky spannen zu lassen. Darin saß zumeist eine Reiterin. Hurtig und glücklich hüpfte das Pseudo-Rösslein vor seinem Gefährt her, immer wieder wohlwollend angetrieben von der steuernden Dame, die ihre sekundären Geschlechtsmerkmale mit einem opulenten Kostüm in Schwarz und Rot betont hatte. Das menschliche Pony wiederum trug sein Zaumzeug im Mund, als wäre der Knebel im Maul das Selbstverständlichste auf der Welt. Und es wurde mit seiner ungewöhnlichen Neigung durchaus nicht allein gelassen. Seine Wege kreuzten sich mit einem Pferdchen, das so wie die Evolution es geschaffen hatte unbekleidet durch den Park trabte. Dann wiederum mühte sich ein Latex-Pony sichtlich dabei ab, einer überdimensionalen Reiterin mit seiner Zugkraft zu gefallen.
Pony-Fetisch nennt die Szene diese Spiele. Man findet sie auch in Österreich. Eingeweihte sprechen von Pet Play. Die tierische Verkleidung muss also nicht auf Huftiere beschränkt sein. Es gibt Pet Play auch ohne Sado-Maso. Die verkleiden sich einfach als Fuchs oder Hase, weil sie so gern Tiere wären. Früher, in Vornetzzeiten, saßen die Menschen in ihren flauschigen Kostümen wohl einsam daheim und wähnten sich auf einer roten Liste origineller Neigungen. Nunmehr finden Pony-Fetischistinnen, Wahl-Truthähne und Wölfe im Kunstpelz leicht ihresgleichen. All das dank Internet.
von Pet Play. Die tierische Verkleidung muss also nicht auf Huftiere beschränkt sein. Es gibt Pet Play auch ohne Sado-Maso. Die verkleiden sich einfach als Fuchs oder Hase, weil sie so gern Tiere wären. Früher, in Vornetzzeiten, saßen die Menschen in ihren flauschigen Kostümen wohl einsam daheim und wähnten sich auf einer roten Liste origineller Neigungen. Nunmehr finden Pony-Fetischistinnen, Wahl-Truthähne und Wölfe im Kunstpelz leicht ihresgleichen. All das dank Internet.
Mir reicht die straighte sommerliche Verkleidung mit Badehose. Aber wenn Sie jetzt ein neues Hobby für sich entdecken: Das Netz bietet Ihnen jede Menge Workshops und Stammtische für Pet Play an.
Stalker-Komödie
(aus: Ö1-GEHÖRT, Juli 2019)
Nehmen Sie am besten Papier und Bleistift zur Hand. Das Stück, das ich Ihnen gleich schildern werde, hat ungefähr so viele Personen und Türen wie eine Komödie von Feydeau.
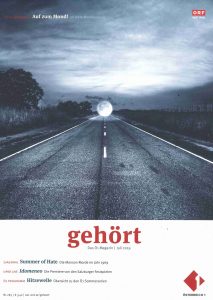 Manuela hat auf dem Handy ihres Sohnes Raphael eine ihr bislang unbekannte App entdeckt: Tellonym. Wenn man sie installiert, kann man anderen anonym Fragen stellen bzw. bekommt auch selbst Fragen von Menschen, deren Identität man bestenfalls vermuten kann. Von der Theorie her klingt das nett, weil Tellonym ein Werkzeug zum Einheben von Meinungen „zur Arbeit oder zu einem Projekt“ sein könnte. Aber was machen 13jährige damit? Logo, sie fragen: „Bist du verliebt?“ oder „Stehst du noch auf J.?“ Oder man nutzt Tellonym, wie im Fall von Manuelas Sohn, als Mobbing-Werkzeug und haut dem Buben aus sicherer Deckung Gemeinheiten um die Ohren, dass es nur so kracht im Gebälk des keimenden Selbstbewusstseins. Manuela erzählte der Liebsten also von dieser Drecksschleuder Tellonym. Schließlich ist unser Großer einer der besten Freunde von Raphael. Natürlich entdeckte die Frau meines größten Vertrauens die App auch auf dem Handy unseres Sohnes. Sofort hat sie sich unter Aurelia15 bei Tellonym registriert und stalkt jetzt den Großen. Aber, der kann mit dem Unding eh ziemlich gut umgehen und entblößt sich auf Fragen wie „Hast du schon mal besondere Gefühle gehabt?“ nicht, sondern übt sich in einer für unsere Familie sonst nicht üblichen, ungeahnt gekonnten Diplomatie (Respekt, Großer!).
Manuela hat auf dem Handy ihres Sohnes Raphael eine ihr bislang unbekannte App entdeckt: Tellonym. Wenn man sie installiert, kann man anderen anonym Fragen stellen bzw. bekommt auch selbst Fragen von Menschen, deren Identität man bestenfalls vermuten kann. Von der Theorie her klingt das nett, weil Tellonym ein Werkzeug zum Einheben von Meinungen „zur Arbeit oder zu einem Projekt“ sein könnte. Aber was machen 13jährige damit? Logo, sie fragen: „Bist du verliebt?“ oder „Stehst du noch auf J.?“ Oder man nutzt Tellonym, wie im Fall von Manuelas Sohn, als Mobbing-Werkzeug und haut dem Buben aus sicherer Deckung Gemeinheiten um die Ohren, dass es nur so kracht im Gebälk des keimenden Selbstbewusstseins. Manuela erzählte der Liebsten also von dieser Drecksschleuder Tellonym. Schließlich ist unser Großer einer der besten Freunde von Raphael. Natürlich entdeckte die Frau meines größten Vertrauens die App auch auf dem Handy unseres Sohnes. Sofort hat sie sich unter Aurelia15 bei Tellonym registriert und stalkt jetzt den Großen. Aber, der kann mit dem Unding eh ziemlich gut umgehen und entblößt sich auf Fragen wie „Hast du schon mal besondere Gefühle gehabt?“ nicht, sondern übt sich in einer für unsere Familie sonst nicht üblichen, ungeahnt gekonnten Diplomatie (Respekt, Großer!).
Aber natürlich geht die Geschichte weiter: Die Liebste hat Brigitte informiert, ihres Zeichens auch besorgte Mutter eines pubertierenden Sohnes namens Benedikt. Da die aber mit den digitalen Werkzeugen nicht so firm ist, muss Aurelia15 Brigittes Sohn jetzt auftragsstalken und weiterleiten, mit welchen Gemeinheiten und Liebesgeschichten Benedikt in seinem virtuellen Leben zu kämpfen hat.
Der Große hat Aurelia15 immerhin sehr schnell enttarnt. (Noch einmal Respekt, Großer!) Keine Ahnung, wie lange ich anonym bleiben kann. Ich stalke die Liebste nämlich jetzt virtuell unter Benny04. Ich weiß ja nicht, ob sie bei ihren häufigen Ausflügen auf Tellonym nicht auf blöde Gedanken kommt.
Schiefe Gesichter
(aus: Ö1-GEHÖRT, Juni 2019)
Sie sind nicht gerecht. Sie sind undurchschaubar. Und sie sind bald allgegenwärtig. Verzeihen Sie, dass ich Sie mit diesem Unbegriff „Algorithmus“ belästigen muss. Diese Rechenanleitungen stecken in allem, was sich Software oder noch spektakulärer „Künstliche Intelligenz“ nennt. Aber wie problematisch und schlecht diese Kochrezepte für Computer sein können, zeigt sich zum Beispiel an der Gesichtserkennung, wie sie von der Polizei, auf Flughäfen oder natürlich von den Internetgiganten eingesetzt wird.
 „Naja, bei mir würde das Programm aufgrund meiner Hautfarbe wohl eh nicht funktionieren“, twittert etwa Aisha. Sie ist dunkelhäutig, wie man auf ihrem Profilbild sieht. Und sie hat Recht. Die MIT-Forscher Joy Buolamwini hat im Vorjahr gezeigt, dass die verbreitetsten Programme nur weiße Männer gut erkennen, weiße Frauen schon schlechter und bei andersfarbigen Menschen fiel die Treffsicherheit ins Bodenlose. Warum? Weil die Systeme halt vorwiegend mit weißen Männern trainiert wurden. Microsoft und das chinesische Face++ reagierten sofort und senkten die Fehlerraten auf nahe null. Amazon hingegen, das sein Gesichtserkennungsprogramm Rekognition u.a. an die US-Polizei verkauft, tat nichts gegen den Fehler, wie netzpolitik.org berichtete.
„Naja, bei mir würde das Programm aufgrund meiner Hautfarbe wohl eh nicht funktionieren“, twittert etwa Aisha. Sie ist dunkelhäutig, wie man auf ihrem Profilbild sieht. Und sie hat Recht. Die MIT-Forscher Joy Buolamwini hat im Vorjahr gezeigt, dass die verbreitetsten Programme nur weiße Männer gut erkennen, weiße Frauen schon schlechter und bei andersfarbigen Menschen fiel die Treffsicherheit ins Bodenlose. Warum? Weil die Systeme halt vorwiegend mit weißen Männern trainiert wurden. Microsoft und das chinesische Face++ reagierten sofort und senkten die Fehlerraten auf nahe null. Amazon hingegen, das sein Gesichtserkennungsprogramm Rekognition u.a. an die US-Polizei verkauft, tat nichts gegen den Fehler, wie netzpolitik.org berichtete.
Leider haben derlei fehlerhafte Algorithmen Folgen. Frauen und Nicht-Weiße werden etwa am Flughafen öfter bei der Kontrolle durchfallen oder bei der Verbrechersuche häufiger fälschlicherweise ausgeworfen.
Mit dem Verweis, es handle sich um Firmengeheimnisse, erlauben die Firmen meist auch keinen Einblick in ihre Programme. So bleiben sie in ihrer ganzen Fehlerhaftigkeit intransparent.
Die EU versucht mit ihren im April veröffentlichten Richtlinien für Künstliche Intelligenz gegenzusteuern. Auch wenn die zahlreichen Industrievertreter die Ethiker und Expertinnen in der High Level Expert Group on Artificial Intelligence zu vielen Kompromissen gezwungen haben, sprechen sich die Empfehlungen doch deutlich für gerechte, ausgewogene und transparente Algorithmen auf Basis europäischer Werte aus.
Jetzt muss sich nur noch die europäische Politik dazu entscheiden, die Richtlinien als Verpflichtung festzuschreiben. Immerhin geht es um unsere Zukunft.
Schlimme Dates
(aus: Ö1-GEHÖRT, Mai 2019)
Die schlimmsten Dates, die ich jemals hatte, sind die Updates. Es beginnt mit einem kleine Stupser am Bildschirm, nach dem Motto: „Du, die Kiste braucht frischen Esprit, lass uns das doch mal machen!“ Nachdem das Notebook gerade so gut läuft, möchte man nichts ändern. Also wird das Drängen aus der Maschine immer heftiger, bald lassen sich die Aufforderungen nur mehr mit einem doppelten digitalen Salto wegklicken. Und irgendwann gibt man auf und nach. Und lässt das Update zu.
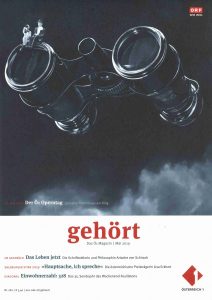 Und danach geht nichts mehr. Jetzt beginnt auf einem anderen Gerät das Suchen, wie man den Computer wieder in den veralteten, aber wenigstens funktionierenden Zustand zurücksetzen kann. Etwa 8 Tage später lässt sich der Kasten – im besten Fall – wieder hochfahren.
Und danach geht nichts mehr. Jetzt beginnt auf einem anderen Gerät das Suchen, wie man den Computer wieder in den veralteten, aber wenigstens funktionierenden Zustand zurücksetzen kann. Etwa 8 Tage später lässt sich der Kasten – im besten Fall – wieder hochfahren.
Ähnlich ist es beim Navi. Seit Monaten drängt es mich mit dem Hinweis, die Karte für das Straßennetz sei veraltet, es auf den neuesten Stand zu bringen. Weil ich mich weigere, täuscht es nun Demenz vor. Obwohl ich mich mitten im Weinviertel aufhalte, zeigt es mich am Schwarzen Meer. Nun muss ich also „updaten“. Diese Bevormundung geht mir schwer gegen den Strich. Es ist doch meine Sache, ob ich in die Irre fahre. Gerade über Umwege habe ich in meinem Leben schon viel entdeckt.
Noch schlimmer ist es bei Apps am Smartphone. Da wird das Update oft zum Vorwand, mir neue Zugriffsrechte abzuringen. Kurz zugestimmt, und schon darf die Taschenlampe am Handy wissen, wessen Kontaktdaten ich gespeichert habe. Das Hauptargument, Updates seien nicht zuletzt nötig, um Sicherheitslücken zu stopfen, ist auch nicht immer überzeugend: Warum lässt man überhaupt so viele Lücken? Updates sind viel eher der indirekte Beweis, dass wir, die KonsumentInnen, Benutzer und Testkaninchen gleichzeitig sind.
Am skurrilsten hat es meinen Fußballkollegen und Journalisten Peter getroffen. Er testete ein amerikanisches Elektromobil. Es holt sich sein Update zu beliebigen Zeiten vom Himmel und begann just damit, als Peter in eine Tiefgarage einfuhr. Daraufhin mochte es sich keinen Zentimeter mehr bewegen. Die Firma schickte einen Spezialwagen, der das E-Mobil gerade ein paar Zentimeter anhob und aus dem updatelosen Bunker schleppte. Da ging das Update angesichts des Himmels wieder weiter. Und das Auto ließ sich schlussendlich wieder starten.
Vollautomatisiert
(aus: Ö1-GEHÖRT, April 2019)
Im Nachhinein betrachtet war es wohl ein Fehler. Ich habe Freund Stefan von den kleinen programmierbaren Mikrocomputern mit WLAN erzählt. Diese Dinger kosten gerade mal zwei bis drei Euro. Stefan, ein Techniker von Herzen, hat daraufhin sofort Sensoren für Temperatur, Licht und Luftfeuchtigkeit in der Wohnküche installiert und sich die Werte am Handy anzeigen lassen. Als er merkte, dass bei jedem Öffnen der Wohnungstür die Luftfeuchtigkeit fällt und man so das Gehen und Kommen dokumentieren kann, ist er in einen veritablen Überwachungsrausch verfallen. In dessen charmantester Ausprägung hat Stefan einen Blubberzähler gebaut, mit dem sich die Gasblasen beim Vergären von Bier zählen und allezeit auf das Handy schicken lassen. Dadurch weiß der Hobbybrauer immer und überall Bescheid, wie es um den Gärprozess steht. Auch hat Stefan den altmodischen Ferraris-Stromzähler mit minimalem Aufwand in ein Smartmeter verwandelt, um den Stromverbrauch aufzuzeichnen.
 Seit in seinem Wohnhaus eingebrochen wurde, sind auf die Eingänge der Wohnung zwei Kameras gerichtet, die er über das Handy bedienen kann. Und wenn ihm die Kameras eine Bewegung melden, kann er vom Smartphone aus eine Lärmmaschine anwerfen – zur Abschreckung der Einbrecher. Jüngst lugte er um halb acht Uhr früh vermittels Handy in die Wohnung und beobachtete seine Kinder, als sie gerade zur Schule aufbrachen. Stefan schreckte sie in väterlicher Zärtlichkeit kurz mit der ohrenbetäubenden Elektrotröte. Die Kinder schrien angeblich sowas wie „Chill dein Leben, Papa“, in die Kamera. Ob er auch seine Ehe schon vollautomatisiert hat, weiß ich nicht. Ich warte aber gespannt auf die nächsten Schritte.
Seit in seinem Wohnhaus eingebrochen wurde, sind auf die Eingänge der Wohnung zwei Kameras gerichtet, die er über das Handy bedienen kann. Und wenn ihm die Kameras eine Bewegung melden, kann er vom Smartphone aus eine Lärmmaschine anwerfen – zur Abschreckung der Einbrecher. Jüngst lugte er um halb acht Uhr früh vermittels Handy in die Wohnung und beobachtete seine Kinder, als sie gerade zur Schule aufbrachen. Stefan schreckte sie in väterlicher Zärtlichkeit kurz mit der ohrenbetäubenden Elektrotröte. Die Kinder schrien angeblich sowas wie „Chill dein Leben, Papa“, in die Kamera. Ob er auch seine Ehe schon vollautomatisiert hat, weiß ich nicht. Ich warte aber gespannt auf die nächsten Schritte.
Auch meinen Nachbarn hat es erwischt. Seit zwei Monaten besitzt er ein „Wischhandy“, das er nicht einmal beim Essen aus der Hand legt. Jüngst ließ uns ein Kuckuck am abendlichen Tisch zusammenzucken. Den hat Hans beim Herumspielen als Klingelton entdeckt. Er ist Waidmann. Und wenn er ins Revier geht und einen Anruf bekommt, so seine Argumentation, werden Reh und Hirsch nicht verschreckt. Den Lautlos-Knopf kennt er nämlich noch nicht. Also, sollten Sie in der Gegend des niederösterreichischen Kaumberg einen Hirsch mit Tinnitus treffen, dann wissen Sie wenigstens, dass der Kuckuck daran schuld ist.
Maschinendämmerung
(aus: Ö1-GEHÖRT, März 2019)
Als Roboter hat man es auch nicht immer lustig. Ein Sicherheitsroboter in San Francisco wurde in eine Plane gewickelt und mit Grillsauce beschmiert, in Osaka verprügelten drei Buben in einem Einkaufszentrum einen Humanoiden, und in Moskau bearbeitete ein Mann einen Roboter mit einem Baseballschläger. Am schlimmsten traf es einen autostoppenden Roboter in San Francisco. Dem rissen Unbekannte den Kopf aus. Fälle wie diese hat kürzlich die New York Times dokumentiert.
 Der US-Kabarettist Aristotle Georgeson nutzt das Roboter-Verdreschen sogar als PR: er postet auf Instagram immer wieder Szenen, in denen Roboter schwer draufzahlen. Diese Videos seien am populärsten unter all den Filmen, die er online stellt, sagt er. Irgendwie lösen die Maschinen ungute Emotionen in uns aus. Und diese Emotionen haben wenig mit der Maschinenstürmerei des 19. Jahrhunderts zu tun, als Weber und andere Arbeiter – für ihr Überleben als Bedrohung empfundene -Gerätschaften wie Webstühle zertrümmerten.
Der US-Kabarettist Aristotle Georgeson nutzt das Roboter-Verdreschen sogar als PR: er postet auf Instagram immer wieder Szenen, in denen Roboter schwer draufzahlen. Diese Videos seien am populärsten unter all den Filmen, die er online stellt, sagt er. Irgendwie lösen die Maschinen ungute Emotionen in uns aus. Und diese Emotionen haben wenig mit der Maschinenstürmerei des 19. Jahrhunderts zu tun, als Weber und andere Arbeiter – für ihr Überleben als Bedrohung empfundene -Gerätschaften wie Webstühle zertrümmerten.
Vor allem humanoide Roboter, die in Figur und äußeren Merkmalen an uns angelehnt sind, bereiten uns Unbehagen. Sie sind uns ähnlich, aber doch nicht wir. Das provoziert das mentale Korsett des Steinzeitmenschen, von dem wir uns bis jetzt nicht ganz lösen können. Er schaltet auf Abwehr, auch mit Gewalt.
Eigentlich gehen wir mit Robotern damit genauso um wie mit Mitmenschen, meint die Kognitionswissenschafterin Agnieszka Wykowska. Da gibt es die, die drinnen sind in der selbstdefinierten Stammesgruppe, und die Außenstehenden, denen wir manchmal mit wenig Feingefühl begegnen.
Kinder in ihrer Ungezähmtheit reagieren ähnlich. In einem Kindergarten behandelten die Kleinen einen Roboter ganz mies und traten ihn, bis ihm die Pädagogin einen Namen gab. Ab diesem Zeitpunkt hörte alle Aggression auf. Als „Tim“ oder „Betty“ rückte er plötzlich näher.
So werden Roboter zu einem Mittel der menschlichen Selbsterkenntnis. Ob uns das ehrt, sei dahingestellt. Wir könnten die vermeintlich menschlich wirkenden Geräte ja auch einfach als das wahrnehmen, was sie sind: tumbe Maschinen für Tätigkeiten, die wir nicht mögen. Und wenn nicht, sollten wir uns wenigstens fürchten, dass sie sich irgendwann erinnern, wer die Hand gegen sie erhoben hat. Und zurückschlagen.
Das Stundenhotel als Technologieopfer
(aus: Ö1-GEHÖRT, Februar 2019)
Neue Technologien leben vielfach von Versprechen. Sie sind wahre Fantasiemaschinen, zeichnen sie uns doch die Zukunft – meist – in den buntesten Farben, getränkt mit nachgerade biblischer Glückseligkeit. Wo immer derzeit die Wörtchen smart oder Künstliche Intelligenz drinstecken, verbirgt sich die Verheißung auf Erlösung von vielen weltlichen Problemen – von der Umweltverschmutzung über zu ungenaue medizinische Diagnosen bis hin zu mehr Gerechtigkeit vor Gericht. Dass das Silicon Valley mit dieser grandiosen Story die Demokratie erodiert, darüber habe ich schon mehrfach lamentiert. Darum beschränke ich mich heute auf das fantasieanregende Element und die netten Erzählungen, die emerging technologies mitliefern.
 Eine meiner liebsten Glaskugel–Studien dazu haben jüngst Forscher aus Oxford und Surrey publiziert. Sie prophezeien, dass autonome Autos das althergebrachte Stundenhotel abschaffen werden. Der sexuelle wird sich demnach in den Straßenverkehr verlagern. Allerdings nur in privaten autonomen Vehikeln. Carsharing-Anbieter werden ihre selbstfahrenden Wägen wohl mit Kameras überwachen und allzu leibliche Aktivitäten vermutlich per „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ verbieten.
Eine meiner liebsten Glaskugel–Studien dazu haben jüngst Forscher aus Oxford und Surrey publiziert. Sie prophezeien, dass autonome Autos das althergebrachte Stundenhotel abschaffen werden. Der sexuelle wird sich demnach in den Straßenverkehr verlagern. Allerdings nur in privaten autonomen Vehikeln. Carsharing-Anbieter werden ihre selbstfahrenden Wägen wohl mit Kameras überwachen und allzu leibliche Aktivitäten vermutlich per „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ verbieten.
Während sich die einen wegen der Roboterautos also eher ausziehen, müssen sich andere warm anziehen: die Chauffeure von Sightseeing-Bussen nämlich und deren Reiseführer. Deren Aufgaben nämlich könnten autonome Autos übernehmen, die Touristen auf fixen Routen durch die Stadt kutschieren. Was dazu führen wird, dass vor Sehenswürdigkeiten wie dem Schloss Schönbrunn dann nicht mehr 30 Reisebusse stehen, sondern 600 selbstfahrende Fahrzeuge. Die brauchen natürlich viel mehr Platz und lösen kein Verkehrsproblem, wie oft versprochen. Sie verschärfen es nur, weil sie ja den sparsamen, ökologisch schonenden, kommunalen Verkehr durch noch mehr Individualverkehr ersetzen. Denn auch Elektroautos brauchen Platz.
Sehr attraktiv wirkt auch die Verheißung, über Nacht im Roboterauto reisen und sich quasi dem Ziel entgegenschlafen zu können.
Dieses Service gibt es allerdings schon längst. Nennt sich Schlafwagen. Hat Beinfreiheit. Und fährt (wie) auf Schienen. Das Bett machen muss man auch nicht selber.
Handy-Kollision
(aus: Ö1-GEHÖRT, Jänner 2019)
Da sag noch einmal einer, dass Smartphones menschliche Nähe verhindern. Im Gegenteil. Und ich meine jetzt nicht den Wisch- und Weg-Tinder-Sex, sondern eine richtige Begegnung. Das begab sich so: Die Dame kam mir mit gesenktem Kopf entgegen, den Blick fest am Handy. Just als wir uns am Gehsteig auf gleicher Höhe befanden, verriss sie plötzlich nach links. Ihr Smartphone bohrte sich irgendwo zwischen Leber und Magen in meinen Oberbauch. Die Fußgängerin entschuldigte sich wortreich, allerdings in einer Sprache, die ich bis heute nicht zuordnen kann. Es klang jedenfalls sehr nett. In jungen Jahren hätte ich sicherlich mit allen mir zur Verfügung stehenden fremdsprachlichen Grundkenntnissen geradebrecht, um die Dame zu einem Kaffee zu bewegen. Jetzt bin ich dank der Liebsten von diesem Zwang zur Pirsch erlöst.
Aber das Smartphone hätte mich und die Dame durchaus zusammenbringen können.
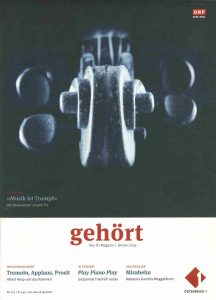 ForscherInnen sehen die Sache etwas nüchterner. Sie sprechen in diesem Zusammenhang von „abgelenktem Gehen“ – und der Grund der Ablenkung war natürlich nicht ich, sondern die Navigationsfunktion am Handy. Studien aus den USA legen nahe, dass durch das Smartphone verursachte Verletzungen bei Fußgängern seit 2010 um mehr als ein Drittel gestiegen sind. Insgesamt dürften sie für jeden zehnten Unfall zu Fuß verantwortlich sein. Österreichische Beobachtungen legen nahe, dass Ablenkung im Jahr 2016 an rund 1.500 Fußgänger-Unfällen schuld war.
ForscherInnen sehen die Sache etwas nüchterner. Sie sprechen in diesem Zusammenhang von „abgelenktem Gehen“ – und der Grund der Ablenkung war natürlich nicht ich, sondern die Navigationsfunktion am Handy. Studien aus den USA legen nahe, dass durch das Smartphone verursachte Verletzungen bei Fußgängern seit 2010 um mehr als ein Drittel gestiegen sind. Insgesamt dürften sie für jeden zehnten Unfall zu Fuß verantwortlich sein. Österreichische Beobachtungen legen nahe, dass Ablenkung im Jahr 2016 an rund 1.500 Fußgänger-Unfällen schuld war.
Der US-Bundesstaat Utah hat auf das globale Problem reagiert und verhängt Geldstrafen für abgelenktes Gehen in der Nähe von Geleisen. Auch Honolulu straft seit dem Vorjahr Menschen, die beim Überqueren der Straße auf ein elektronisches Gerät starren.
Noch schlimmer dürfte die Ablenkungswirkung im Auto sein. Wer beim Fahren etwa Kurznachrichten schreibt, soll angeblich so schlecht fahren, als hätte er 0.8 Promille Alkohol im Blut. Wohl auch deshalb ist abgelenktes Fahren bereits für mehr Straßentote verantwortlich als übermäßiges Trinken.
So gesehen ging die Kollision mit der Dame recht glimpflich aus – unfall- wie liebestechnisch.
Lasst uns doch müde sein!
(aus: Ö1-GEHÖRT, Dezember 2018)
 Freund Ulrichsberger ist Anwalt. Er hatte mit der digitalen Welt bislang nicht sehr viel am Hut. Seit er ein Heavy-Duty-Handy hat – im Grunde ein unverwüstliches Smartphone für Baggerfahrer – ist vieles anders. Jetzt beantwortet er ab und zu schon SMS und interessiert sich für originelles elektronisches Spielzeug. Zuletzt rief er mich an, weil ich von einem „smarten System“ berichtet hatte, das Angestellte mit kalter Luft anbläst, sobald sie im Begriff sind, einzuschlafen. Das steigert die Produktivität. Denn in der Leistungsgesellschaft schickt es sich einfach nicht, müde, geschweige denn erschöpft zu sein. Aber was tut Ulrichsberger? – Er will die Gerätschaft aus Japan nicht für seine Mitarbeiter anschaffen, sondern für sich selbst – wenn er bei Gericht mit der Müdigkeit kämpft, rein zum Selbstschutz.
Freund Ulrichsberger ist Anwalt. Er hatte mit der digitalen Welt bislang nicht sehr viel am Hut. Seit er ein Heavy-Duty-Handy hat – im Grunde ein unverwüstliches Smartphone für Baggerfahrer – ist vieles anders. Jetzt beantwortet er ab und zu schon SMS und interessiert sich für originelles elektronisches Spielzeug. Zuletzt rief er mich an, weil ich von einem „smarten System“ berichtet hatte, das Angestellte mit kalter Luft anbläst, sobald sie im Begriff sind, einzuschlafen. Das steigert die Produktivität. Denn in der Leistungsgesellschaft schickt es sich einfach nicht, müde, geschweige denn erschöpft zu sein. Aber was tut Ulrichsberger? – Er will die Gerätschaft aus Japan nicht für seine Mitarbeiter anschaffen, sondern für sich selbst – wenn er bei Gericht mit der Müdigkeit kämpft, rein zum Selbstschutz.
So ist die Technologie. Immer janusköpfig.
Die Leistungskontrolle bei Arbeitnehmerinnen und –nehmern scheint jedenfalls zu boomen. Forscher einer amerikanischen Universität haben eine App entwickelt, die die Wachsamkeit der Nutzer über die Augen misst. Immer, wenn man sein Handy entsperrt, nimmt es ein Foto der Pupille auf und analysiert es. Postwendend teilt die App dann mit, ob der Energielevel gesunken ist. Dabei kommt den Entwicklern auch zugute, dass Menschen im Schnitt rund 90mal pro Tag das Smartphone in die Hand nehmen. Ob das Handy bei sinkender Energie Stromschläge austeilt, ist aus dem Beipackzettel nicht zu erschließen. Ich warte aber nur noch darauf, dass auch der Lohn an die Messwerte der App angepasst wird.
Eine Münchner Firma geht noch einen Schritt weiter. Sie hat ein Eyetracking-System zusammengebaut, das unten an den Monitor geklemmt wird. Damit lassen sich die Augen wie eine Computermaus nutzen. Wenn Designer etwa das Gehäuse eines Haushaltsgeräts entwerfen, legen sie mit ihrer Maushand oft weite Strecken zurück. Lässt man sie jetzt mit dem Auge klicken, erspart das 30-45 Minuten pro Tag. Oder ganz privat: Mit Eyetracking kann man seine Emails beim Frühstück mit den Augen löschen, ohne sein Croissant fallen lassen zu müssen.
Mein Freund Ulrichsberger verweigert derartige Optimierungsorgien glücklicherweise. Aber er hat mir gestanden, er warte nur mehr darauf, dass ein „findiger“ Kopf als nächstes die Ohren als Arbeitsgeräte entdeckt. Denn die hätten sich jetzt wirklich lange genug als Leistungsverweigerer profiliert.
Porno-Boom
(aus: Ö1-GEHÖRT, November 2018)
Wenn Sie das Netz vor allem für Wikipedia oder Twitter nutzen, dann gehören Sie zu einer Minderheit. Oder Sie schummeln. Die Mehrheit schaut im Netz nach Pornoseiten. Das behauptet zumindest eine Studie von SimilarWeb. Das IT-Unternehmen erstellte für Deutschland eine Liste der beliebtesten Online-Portale, gemessen an der Zeit, die die Nutzer dort verbringen.
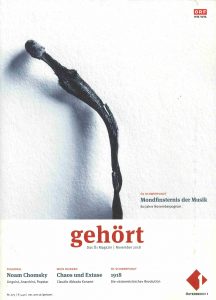 Ähnlich ist die Situation in den USA. Dort liegen vier Pornowebseiten unter den Top-20. Sie sind damit populärer als der Bezahldienst Paypal oder das Berufsnetzwerk LinkedIn.
Ähnlich ist die Situation in den USA. Dort liegen vier Pornowebseiten unter den Top-20. Sie sind damit populärer als der Bezahldienst Paypal oder das Berufsnetzwerk LinkedIn.
Das hat auch etwas Positives, könnte man meinen: Wenn Menschen mehr Pornos schauen, verbringen Sie weniger Zeit damit, Hasskommentare und Schmuddelgeschichten in Sozialen Medien abzusondern.
Aber so einfach ist die Sache leider nicht. Wie eine Untersuchung der Indiana State University belegt, werden die Online-Porno-Konsumenten immer jünger. So sollen bereits 13jährige Buben und 14jährige Mädchen, zumindest in den USA, regelmäßig Sexfilmchen im Netz ansehen. Der anatomische Lerneffekt dürfte dabei sehr beschränkt sein. Nicht so die Kollateralschäden, die das weltfremde Kunstgerammle bei denen anrichtet, die gerade erst das sexuelle Leben entdecken und von den artifiziellen Geschlechtsakten (falsch) geprägt werden. Die Instant-Befriedigung der Online-Sexfilme vermittelt keinen Hauch von Intimität, die für ein gleichermaßen spannendes wie entspanntes Sexleben notwendig ist. Sex wird zum schnell konsumierbaren Gebrauchsgut und schmeckt bald so intensiv wie schaler Automatenkaffee.
Die deutsche Sexualtherapeutin Heike Melzer sieht in den Online-Pornos entsprechend wenig Befreiendes, wie Spätachtundsechziger vielleicht meinen könnten, sondern viel mehr Einschränkendes. (Junge) Leute bekommen eine völlig falsche Vorstellung von gemeinsamer Körperlichkeit. Die Folge: In Melzers Praxis tauchen zunehmend jüngere Patienten auf, mit dem Smartphone in der linken und Viagra in der rechten Hand.
Na bravo.
Vielleicht haben manche das Sprachbild vom „Verkehr auf der Datenautobahn“ echt missverstanden.
Alltagshacker
(aus: Ö1-GEHÖRT, Oktober 2018)
Halmer ist ein militanter Verfechter der Rasenkultur. Läge sein Grundstück nicht am Hang, man könnte darauf prima Tennis spielen. Nun aber hat sich Halmer einen Rasenmäher-Roboter angeschafft. Statt von der Terrasse aus den kleine Sensenmann zu beobachten, läuft Halmer oft stundenlang in meditativer Geschwindigkeit nahe null hinter dem Roboter her. Und das nur, weil der autonome Rasenmäher anfangs ein paarmal irgendwo hängen blieb und dann um Hilfe piepste.
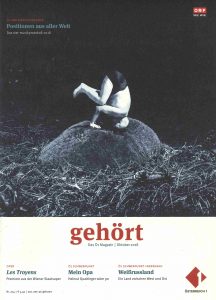 In diesem Fall hat die Maschine dem Menschen ihren „Willen“ aufgezwungen. Glücklicherweise passiert es viel öfter, dass sich Menschen über den vordergründigen Maschinenzweck hinwegsetzen und sich quasi von der Knebelung der Maschine emanzipieren. Freund Ulrichsberger, der ob seines originellen psychischen Korsetts an dieser Stelle schon öfter Erwähnung fand, wusch zum Beispiel zu Studienzeiten einen Teil seiner Wäsche im Geschirrspüler. Von bakteriologischen Nebenwirkungen bei seinen WG-Genossen ist glücklicherweise nichts bekannt.
In diesem Fall hat die Maschine dem Menschen ihren „Willen“ aufgezwungen. Glücklicherweise passiert es viel öfter, dass sich Menschen über den vordergründigen Maschinenzweck hinwegsetzen und sich quasi von der Knebelung der Maschine emanzipieren. Freund Ulrichsberger, der ob seines originellen psychischen Korsetts an dieser Stelle schon öfter Erwähnung fand, wusch zum Beispiel zu Studienzeiten einen Teil seiner Wäsche im Geschirrspüler. Von bakteriologischen Nebenwirkungen bei seinen WG-Genossen ist glücklicherweise nichts bekannt.
Auf der Seite ikeahackers.net finden sich mehr als 5.000 Anleitungen, wie man Geräte der schwedischen Möbelschleuder zweckentfremden und etwa einen Kindertisch zu einem Biotop für Sukkulenten umbauen kann. Das nenn ich mal Aneignung von Technik, statt sich ihr passiv zu unterwerfen, wie wir es im Alltag fast immer tun. (Die Spezialisten sprechen dabei von Life Hacks.) Mittlerweile hat sich etwa eine eigene Design-Szene rund um Euro-Paletten entwickelt, die Betten genauso daraus baut wie Regale, Sitzmöbel oder Fahrradständer.
Originell finde ich auch die Zubereitung von quasi-pochierten Eiern im Filter einer Kaffeemaschine, auch wenn ich es (noch) nicht probiert habe. Wobei sich Hacks in der Küche generell großer Beliebtheit erfreuen. Der Wirt im Ort bügelte früher bei Caterings Zanderfilets zwischen Butterpapier gar, statt sie auf der heißen Platte zu braten. Und bei größerem Obstanfall schält die Minderheit in der Familie – also die Buben und ich – die Äpfel mit Hilfe des Akkuschraubers.
Nicht immer muss ein Life Hack funktionieren. Als der Große noch klein war, telefonierte er gerne mit der Oma. Einmal war sie um die Welt nicht zu erreichen. Er hatte nämlich die Fernbedienung für das TV-Gerät erwischt.
FOMO
(aus: Ö1-GEHÖRT, September 2018)
Stünde Schnittlauchlocke im Berufsleben: man könnte ihn mit Fug und Recht als Multifunktionär bezeichnen. Neben Fußball in drei Mannschaften geht unser 9jähriger auch noch anderen Sportarten nach oder spielt Gitarre. Nicht, weil ihn jemand dazu zwingen würde. Es entspricht seiner Betriebstemperatur. Er ist einfach rührig. Jüngst stand er wieder einmal mit hängenden Schultern da, weil ein Fußballspiel, bei dem er sich unabkömmlich wähnte, zur selben Zeit stattfand wie eine Geburtstagsfeier und eine Poolparty. Und er wollte nichts davon auslassen.
 „Fear of Missing Out“ nennt sich die Befürchtung, man könnte irgendetwas versäumen. Seit 2013 steht diese Angst mit ihrem Akronym FOMO sogar im Oxford Dictionary. Natürlich dank sozialer Medien. Denn die ständige Beschallung mit dem Leben anderer verstärkt solche Versäumnisgefühle sogar noch. Es muss ja einen Grund haben, warum Menschen im Schnitt 75mal pro Tag auf ihr Smartphone schauen.
„Fear of Missing Out“ nennt sich die Befürchtung, man könnte irgendetwas versäumen. Seit 2013 steht diese Angst mit ihrem Akronym FOMO sogar im Oxford Dictionary. Natürlich dank sozialer Medien. Denn die ständige Beschallung mit dem Leben anderer verstärkt solche Versäumnisgefühle sogar noch. Es muss ja einen Grund haben, warum Menschen im Schnitt 75mal pro Tag auf ihr Smartphone schauen.
Wie Manfred Poser in seinem Buch #fomo schreibt, gaben bei einer Befragung von mehr als 1000 Menschen mit einem Durchschnittsalter von 28 Jahren immerhin 28 Prozent an, lieber auf Sex verzichten zu wollen als auf ihr Handy.
Dabei ist das strahlende Leben der Anderen, an dem wir über Facebook, Instagram oder Snapchat Anteil haben, ein Trugbild. Es ist eine Abfolge wirklicher oder inszenierter Höhepunkte, eine Abfolge von Hochglanzmomenten in der ganz alltäglichen Timeline, vom außergewöhnlichen Sonnenuntergang vor Koh Samui bis zur gelungenen Paella am Gasring in der Outdoor-Küche. Von den langen Zeiten zwischen diesen raren Vorzeigemomenten, den Strapazen des Reisens oder den verbrannten Töpfen, erfahren wir in der Regel nichts in den sozialen Medien. Wohl deshalb unterliegen wir vielfach der Zwangsvorstellung, das Leben würde andernorts stattfinden, getreu dem Motto „Das Glück ist immer dort, wo ich nicht bin.“
Manche bezeichnen FOMO, die Angst etwas zu versäumen, auch als technologie-induzierten Weltschmerz. Soweit ist es bei Schnittlauchlocke noch nicht. Er verlangt glücklicherweise noch nicht nach einem Smartphone und Zugang zum weltweiten Basar der Eitelkeiten. Deshalb muss ich ihm auch nicht nahelegen, auf https://psychcentral.com/quizzes/fomo-quiz/ zu testen, ob er schon unter Social Media-FOMO leidet.
Patschen-Museen
(aus: Ö1-GEHÖRT, August 2018)
Kürzlich bin ich in das frühe 19. Jahrhundert gereist, an den Fuß des Pasterzen-Gletschers unter dem Großglockner. Der hat sich vor knapp 200 Jahren wirklich noch weit ins Tal gestreckt. Der Landschaftsmaler Thomas Ender hat die Pasterze in Öl dokumentiert. Die Salzburger Residenz-Galerie zeigt das Gemälde nicht nur physisch, sondern auch in einer Online-Ausstellung. (Trump würde das Bild für ein Fake der Klimawandel-Apologeten halten, aber was macht das schon.)
 Ich bin mittlerweile ein Fan von Museumsbesuchen via Netz – nicht nur, wenn das Wetter gerade auslässt und ich am Wochenende einfach zu müde bin, um noch etwas zu unternehmen. Eine meiner liebsten Adressen ist die Europeana. Derzeit zeigt dieses europäische Projekt u.a. berührende Postkarten aus dem ersten Weltkrieg. Abgesehen von solchen Spezialausstellungen, etwa in Zusammenarbeit mit der Österr. Mediathek über österr. Exil-Komponisten wie Erich Wolfgang Korngold, bietet die Europeana rund eine halbe Million weiterer Exponate – ein Schlaraffenland für Reisende, die mehr auf geistige als physische Mobilität setzen.
Ich bin mittlerweile ein Fan von Museumsbesuchen via Netz – nicht nur, wenn das Wetter gerade auslässt und ich am Wochenende einfach zu müde bin, um noch etwas zu unternehmen. Eine meiner liebsten Adressen ist die Europeana. Derzeit zeigt dieses europäische Projekt u.a. berührende Postkarten aus dem ersten Weltkrieg. Abgesehen von solchen Spezialausstellungen, etwa in Zusammenarbeit mit der Österr. Mediathek über österr. Exil-Komponisten wie Erich Wolfgang Korngold, bietet die Europeana rund eine halbe Million weiterer Exponate – ein Schlaraffenland für Reisende, die mehr auf geistige als physische Mobilität setzen.
Ein paar Klicks weiter schrumpft die Welt zu einer kleinen Kugel, halb so groß wie jetzt. Der Indische Ozean ist ein Binnenmehr, Skandinavien wirkt richtiggehend zerfleddert, und im Zentrum des Globus liegt Jerusalem: so gesehen auf einer Online-Weltkarte aus dem Jahr 1485, 7 Jahre bevor Amerika Platz auf den Karten zu beanspruchen begann. Zu finden sind historische Kartenblätter hochaufgelöst in der Online-Präsentation der Sammlung Woldan. (Die Wieder-Weltkarte hat übrigens auch das Paradies eingezeichnet – es liegt ganz am Rand, am äußersten Ende von Asien, und wird vom Tigris mit Wasser versorgt, falls wer danach sucht.)
Ein paar Jahrhunderte später stirbt der bürgerliche Kleidermacher, Franz Rabensteiner, im Salzburger Bürgerspital, 63 Jahre alt, an Auszehrung. Das entnehme ich dem Salzburger Intelligenzblatt vom 9. August 1806. Auch historische Zeitungen wie diese sind im Netz zu finden, im virtuellen Lesesaal der Österr. Nationalbibliothek.
Und wer gern in die jüngere akustische Vergangenheit eintaucht, um zum Beispiel eine analoge Schreibmaschine samt Klingelton am Ende der Zeile zu hören: dem empfehle ich conservethesound.de. Dort ist auch das Rattern eines Wählscheibentelefons zu finden. Schnittlauchlocke, meinem 9jährigen Sohn, musste ich übrigens erst erklären, wozu man diese Dinger früher nutzte.
Die Kürze der Ewigkeit
(aus: Ö1-GEHÖRT, Juli 2018)
Ulrich erlebte jüngst sein Daten-Waterloo. Er hatte vor etwa 15 Jahren das filmische Vermächtnis der Familie von 8mm-Farbfilm auf einige DVDs umkopieren lassen. Als Kinder hatten wir uns vor Lachen gebogen, wenn sein Vater die Filme rückwärts laufen ließ und Ulrich aus dem Wasser wieder auf das Drei-Meter-Brett zurück flog oder mit den Sohlen voran aus den Fluten vor Jesolo auftauchte und wieder trocken ins Boot sprang.
 Diese Familiengeschichte ist nun verloren, weil die DVDs kaputt sind. Entweder er hatte sie zu warm gelagert oder sie haben sich ganz natürlich zersetzt. So genau weiß das niemand. Natürlich hatte Ulrich die Filmbänder nach dem Umkopieren entsorgt. Weil digital ist ja gleichbedeutend mit ewig, dachte er.
Diese Familiengeschichte ist nun verloren, weil die DVDs kaputt sind. Entweder er hatte sie zu warm gelagert oder sie haben sich ganz natürlich zersetzt. So genau weiß das niemand. Natürlich hatte Ulrich die Filmbänder nach dem Umkopieren entsorgt. Weil digital ist ja gleichbedeutend mit ewig, dachte er.
Das erinnert mich an den Beginn der CDs. Die wurden anfangs auch mit ihrer ewigen Haltbarkeit angepriesen. Schnell schrumpfte diese Ewigkeit aber auf ein paar Jahre. Das merkte man vor allem dann, wenn die Lieblings-CD nach ein paar Jahren nur mehr mit unschönen Rucklern und elektronischen Klicksern abspielbar war.
Noch schlimmer ist es um die Haltbarkeit von Festplatten bestellt. Im Mittel überleben sie nur rund 5 Jahre. Manche geben schon nach 2 Jahren ihren Geist auf. Das hat in meiner Datenverlust-Paranoia dazu geführt, dass ich die tausenden Familienfotos, zu denen jedes Jahr eine vierstellige Anzahl dazu kommt, mittlerweile auf vier Festplatten sichere. Einmal habe ich übrigens in die falsche Richtung gesichert und damit einen Teil der Geschichte gelöscht.
Moderne Speichermedien wie die M-Disc oder die Archival Disc sollen übrigens 1000 Jahre halten. Diese Versprechen erinnern fatal an die anfänglichen Ewigkeitsprognosen rund um die CD.
Aber auch moderne analoge Speichermedien sind vom Zahn der Zeit nicht verschont. Bücher mit säurehaltigem Papier aus Holz überleben meist nur wenige Jahrzehnte. Das Lumpenpapier auf Leinenbasis, auf dem Gutenberg druckte, war weitaus haltbarer.
Wenn Ulrich heuer aus dem Urlaub zurückkommt, wird er seine Fotos und Filme mindestens zweifach sichern, hat er gemeint, vielleicht sogar in der Cloud. Eines wird er auf jeden Fall lernen: wie ein wirklich gutes Speichermedium aussieht. Er fährt nämlich nach Ägypten zu den in Stein gemeißelten Hieroglyphen.
Die Muße ist analog
(aus: Ö1-GEHÖRT, Juni 2018)
Nein, die 50. Kolumne wird kein kulturpessimistisches Geraunze über das Handy und auch kein rituelles Tech-Bashing. Aber…
Das Aber kommt später.
 Ich gestehe zuerst einmal: Ich nutze das Smartphone gerne als russische Fellhaube. Wenn ich in der U-Bahn oder im Zug sitze, dann stülpe ich es mir via Kopfhörer über, damit ich die trostlosen Privatheiten meiner Umgebung nicht mitanhören muss. Manchmal nehme ich nur die Kopfhörer und schließe sie nicht mal an. Von wegen Kommunikation: Ich komme sowieso nur in Ausnahmefällen auf die Idee, mit Wildfremden zu reden.
Ich gestehe zuerst einmal: Ich nutze das Smartphone gerne als russische Fellhaube. Wenn ich in der U-Bahn oder im Zug sitze, dann stülpe ich es mir via Kopfhörer über, damit ich die trostlosen Privatheiten meiner Umgebung nicht mitanhören muss. Manchmal nehme ich nur die Kopfhörer und schließe sie nicht mal an. Von wegen Kommunikation: Ich komme sowieso nur in Ausnahmefällen auf die Idee, mit Wildfremden zu reden.
Ich schätze auch den allzeit bereiten Fotoapparat in meiner Hosentasche und die allgegenwärtigen Stadtpläne, wenn das Navi im äußersten Mühlviertel wieder mal mitten in den Feldern den Dienst versagt.
Auch die Warnung vor den gehässigen Pollen ist mir willkommen und die Online-Radiothek, die ich ständig mit mir herumtrage. Es gibt so vieles, was man am Mini-Computer mit Telefonfunktion loben könnte.
Aber: Das Smartphone hat uns die Muße geraubt.
Das wurde mir jüngst in der vollbesetzten Bahn bewusst, als ich gerade erschöpft vor mich hinstarrte und rings um mich nur nervös tippende oder wischende Finger sah und Hände, die sich um kleine schwarze Dinger klammerten. Die Muße: das ist die zwecklose Zeit im besten Sinn, jene Zeit, die – eventuell begleitet von einem trostlosen Blicks ins Nirgendwo – Neues Gebären kann, in der man vielleicht auch mal sein Leben in Frage stellt oder entscheidet, zu Neuem aufzubrechen. Muße ist zu einem raren Gut geworden, weil wir ständig beschäftigt sind mit unseren Smartphone-Prothesen, weil uns der Kommunikations-Knüppel mit seiner Instantbefriedigung von Bedürfnissen, die wir früher nie hatten, so in seinen Bann zieht.
Funktioniert auch bei mir, keine Frage. Und vor allem sieht man alle Untugenden an anderen viel besser als an sich selbst. Aber wenn man das Smartphone mal weglegt und kurze Zeit unbeschäftigt ist, beginnt der Kopf, Grundlagenforschung zu betreiben. Dabei schaut bekanntermaßen nicht immer etwas Brauchbares raus. Ohne Muße hingegen hat man garantiert keine neuen Ideen.
Jetzt weiß ich was: Vielleicht sollte ich eine Muße-App erfinden!
War nur ein Scherz.
Trügerische Bilder
(aus: Ö1-GEHÖRT, Mai 2018)
Die digitale Welt riecht nicht. Schade eigentlich. Die Nase ist nämlich unser unbestechlichster Sinn und lässt sich am wenigsten täuschen. Ganz anders als das Auge. Was wir sehen, gilt schnell einmal als wahr.
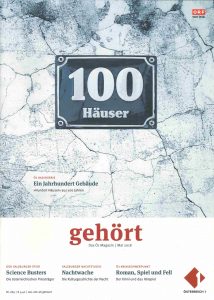 Aber gerade in Sachen Bildlichkeit scheint sich jede Vertrauenswürdigkeit in Luft aufzulösen, dank Bildbearbeitung und Künstlicher Intelligenz. Im Herbst zeigten ein paar verhaltensoriginelle Bastler, was mit Hilfe guter Software möglich ist: Sie tauschten die Gesichter von Pornodarstellern bei der Arbeit gegen jene von Berühmtheiten aus und deponierten die Schmuddelfilmchen auf diversen Webseiten. Auf den ersten Blick war der Schwindel nicht zu erkennen. Und natürlich verbreiteten sich die Videos so rasant, dass selbst die Anbieter einschlägiger Seiten die Notbremse zogen und die Fake Pornos – im Rahmen einer neu geschaffenen anti-face-swap porn policy – von ihren Portalen verbannten. Die optische Erschütterung ging unter dem Stichwort deepfakes in die Geschichte der Künstlichen Intelligenz und des Internets ein.
Aber gerade in Sachen Bildlichkeit scheint sich jede Vertrauenswürdigkeit in Luft aufzulösen, dank Bildbearbeitung und Künstlicher Intelligenz. Im Herbst zeigten ein paar verhaltensoriginelle Bastler, was mit Hilfe guter Software möglich ist: Sie tauschten die Gesichter von Pornodarstellern bei der Arbeit gegen jene von Berühmtheiten aus und deponierten die Schmuddelfilmchen auf diversen Webseiten. Auf den ersten Blick war der Schwindel nicht zu erkennen. Und natürlich verbreiteten sich die Videos so rasant, dass selbst die Anbieter einschlägiger Seiten die Notbremse zogen und die Fake Pornos – im Rahmen einer neu geschaffenen anti-face-swap porn policy – von ihren Portalen verbannten. Die optische Erschütterung ging unter dem Stichwort deepfakes in die Geschichte der Künstlichen Intelligenz und des Internets ein.
Diese Art Manipulation scheint nur eine konsequente Weiterführung der fast schon altmodisch anmutenden Photoshop-Retuschen von Bildern. Ein befreundeter Fotograf erzählte mir kürzlich, dass das Behübschen von Porträts auf Wunsch der Auftraggeber mittlerweile schon mehr Zeit einnehme als das Fotografieren selber. Aber trotzdem lassen sich Menschen noch immer von den künstlichen Model-Looks deprimieren.
Und selbst die Wissenschaft hat sich die Möglichkeiten der Bildmanipulation längst zu Eigen gemacht: Wann immer wir glänzende, blau und rot funkelnde Bilder des Universums präsentiert bekommen, sind dies keine Fotografien. Es sind Bilder, die aus den Daten von Teleskopen und Sondern generiert wurden, kulturelle Interpretationen und/ oder PR-Materialien, die mit der optischen Wirklichkeit des Weltalls nur bedingt zu tun haben.
Wobei mir die fotografische Treffsicherheit bei der Abbildung des Kosmos am wenigsten Sorgen macht. Vielmehr sorge ich mich darum, wie sehr wir digitalen Bildern noch glauben dürfen. Und wie ihre quasi-perfekte Manipulierbarkeit auch populistisch missbraucht werden kann. Vom Gedanken, dass ein Bild die Wirklichkeit so wiedergibt, wie wir das von der analogen Fotografie kennen, müssen wir uns jedenfalls verabschieden.
Wunderwörter
(aus: Ö1-GEHÖRT, April 2018)
Wörter sind wie Elixiere. Sie machen uns stark für die Zukunft oder befreien uns von Leiden der Gegenwart. Und manchmal sind sie auch ein bissl giftig. Aber das merkt man auf den ersten Blick nicht.
 Die Technik- und IT-Branche hat ein besonderes Talent, uns ihre Elixiere in schöner Wortverpackung zu verkaufen. Zu den Wunderessenzen, die momentan in aller Munde sind, gehört die Blockchain. Das dezentrale Vertrags- und Bezahlsystem, auf dem auch die virtuelle Währung Bitcoin beruht, wird unseren Umgang mit Abrechnungen und Abmachungen aller Art tatsächlich revolutionieren. Aber als Normalsterblicher hat man den Eindruck, dass man bald nicht mal mehr eine Semmel ohne Blockchain kaufen kann. Das Wort ist zu einem glänzenden Verkaufsargument jenseits seiner ureigenen Bedeutung geworden, einer riesigen Geldeinspielmaschine für Börsengänge, die sich nun ICOs – Initial Coin Offerings – nennen. Es sollen sich sogar Börsenkurse von Unternehmen aus der „old economy“ innerhalb kürzester Zeit verdoppelt haben, wenn sie sich das Wunderwort Blockchain umhängten.
Die Technik- und IT-Branche hat ein besonderes Talent, uns ihre Elixiere in schöner Wortverpackung zu verkaufen. Zu den Wunderessenzen, die momentan in aller Munde sind, gehört die Blockchain. Das dezentrale Vertrags- und Bezahlsystem, auf dem auch die virtuelle Währung Bitcoin beruht, wird unseren Umgang mit Abrechnungen und Abmachungen aller Art tatsächlich revolutionieren. Aber als Normalsterblicher hat man den Eindruck, dass man bald nicht mal mehr eine Semmel ohne Blockchain kaufen kann. Das Wort ist zu einem glänzenden Verkaufsargument jenseits seiner ureigenen Bedeutung geworden, einer riesigen Geldeinspielmaschine für Börsengänge, die sich nun ICOs – Initial Coin Offerings – nennen. Es sollen sich sogar Börsenkurse von Unternehmen aus der „old economy“ innerhalb kürzester Zeit verdoppelt haben, wenn sie sich das Wunderwort Blockchain umhängten.
Besonders giftig finde ich sharing economy. In einer Zeit, in der weniger geteilt wird denn je, gaukelt uns der Begriff eine Lawine an Altruismus vor, die diametral von seiner wahren Bedeutung entfernt ist. Sharing economy ist die Durchökonomisierung des Alltags, und das Wort stammt nicht durch Zufall aus der Gebärmutter des IT-gestützten Neoliberalismus, aus dem Silicon Valley. Nur weil man seine leerstehende Wohnung über AirBnB vermietet oder mit dem eigenen Fahrrad Essen für einen internationalen Konzern ausfährt, teilt man doch noch nicht. Als ich und meine Brüder in den 70er-Jahren aus unserem Kinderzimmer ausziehen mussten, damit unsere Eltern den Raum an Gäste vermieten konnten, war das nicht Teilen: Es war eine Einkommensquelle, halt nicht vermittelt über eine Plattform im Netz, sondern vom lokalen Tourismusbüro. Ganz entgegen meiner sonstigen Gewohnheit würde ich beim Teilen den Benchmark ganz traditionell beim Heiligen Martin ansetzen. Der hat seinen Mantel ohne Gegenleistung und ohne ein mitschneidendes CoatBnB geteilt.
Viel charmanter ist Hashtag. Er ist der Espresso des Internets. Weil er etwas (in einem Schlagwort) zu verdichten sucht. Was häufig nicht gelingt. Weshalb ich diese Kolumne kurz und bündig mit dem Hashtag schließe #Daswarjetztetwasdasichmirvonderseeleschreibenmusste.
Smarte Doppelmoral
(aus: Ö1-GEHÖRT, März 2018)
Ist Ihnen schon mal aufgefallen, wie wenig sich andere Menschen von ihrem Smartphone trennen können und wie oft sie im Hosentaschencomputer buchstäblich versinken? An der Bushaltestelle, vor einem Geschäft, im Pub, am Sportplatz. Und natürlich sind es immer nur die Anderen. Besonders schlimm ist die Smartphone-Abhängigkeit bei jungen Menschen. Das wurde mir jüngst bewusst, als ich über das Buch „Jetzt pack doch mal das Handy weg!“ von Thomas Feibel berichtete. Aus Übermut und weil ich mich über jegliche Vorwürfe erhaben fühlte, habe ich meinen 12jährigen Sohn zum Umgang seiner Eltern mit dem Handy interviewt.
Manno, da hat uns der Große aber die Leviten gelesen.
 Die Doppelmoral, der wir sogenannten Erwachsenen beim Umgang mit dem Smarthphone aufsitzen, lässt sich auf eine Handvoll Selbstlügen und Wirklichkeitsverbiegungen reduzieren, hier drei davon.
Die Doppelmoral, der wir sogenannten Erwachsenen beim Umgang mit dem Smarthphone aufsitzen, lässt sich auf eine Handvoll Selbstlügen und Wirklichkeitsverbiegungen reduzieren, hier drei davon.
Erstens: Wenn man selber auf das Handy sieht, ist das immer wichtiger, als wenn andere das tun. Wir beantworten nämlich ab und an ein berufliches Mail, während die anderen irgendwo im Netz rum hängen oder eines der sinnlosen Spiele zocken, von denen die Handywelt voll ist. Und wenn das eigene Smartphone beim Familienspiel bimmelt, muss man selbstverständlich nachschauen, während der Nachwuchs das Teufelszeug gefälligst liegen lassen soll.
Zweitens: Das Handy ist für viele mindestens so wichtig beim Gedeck wie Messer, Gabel und Löffel. Deshalb wird es auch rechts neben dem Teller aufgelegt, daheim und im Restaurant. Das verändert laut der amerikanischen Techniksoziologin Sherry Turkle die Gespräche am Tisch. Selbst bei ausgeschaltetem Handy oder verdecktem Display hören Menschen nicht so aufmerksam zu wie bei einem Essen ohne Smartphone.
Drittens: Das Smartphone ist ein wunderbares Werkzeug, um Kinder ruhig zu stellen. Quengeln sie bei einer langen Autofahrt oder werden sie im Gasthaus unruhig, während man sich noch unterhalten möchte, stopft man ihnen statt einem Schnuller in den Mund das Handy in die Hand. Und flugs geben sie Ruh. Soviel zur Vorbildwirkung und wie wir sie nicht erfüllen.
Seit dem Gespräch mit dem Großen versuchen wir uns immer wieder mit den Augen der Kinder zu sehen, wenn wir zum Smartphone greifen. Und wir fragen uns, ob wir es gut fänden, würden sie uns nachahmen. Die Antwort ist zwar nicht immer schön, aber hilfreich.
Digi-Doping
(aus: Ö1-GEHÖRT, Februar 2018)
Nur wenige Wochen, nachdem Arthur Linton 1896 das Rennen Bordeaux-Paris gewonnen hat, ist der Radrennfahrer tot. Er gilt als der erste Doping-Tote im Sport der Neuzeit. Sein Trainer hat ihm Spezialalkohol eingeflößt und damit sein Immunsystem zu sehr geschwächt. Schon in der Antike haben Sportler etwa mit Stierhoden experimentiert, um sich von Konkurrenten leistungsmäßig abzusetzen. Verglichen mit dem, was das dritte Jahrtausend an Leistungsverstärkern bieten wird, sind diese Mittel auf gut Wienerisch ein „Lercherl“.
 Der Zukunftsforscher Ian Pearson erwartet sich zum Beispiel schon im nächsten Jahrzehnt elektronische Kontaktlinsen, die so gut sind wie unser Auge und uns bald übernatürlich detailliert wie durch ein Mikroskop sehen lassen. Durch Gedanken gesteuerte Prothesen könnten unseren Spielraum über unsere biologischen Körpergrenzen hinweg ebenso ausdehnen, ein Gehirnimplantat lässt uns dann vielleicht Vornamen von Gesprächspartnern nie wieder vergessen, weil sie über eine Art sozialen Datenstrom eingespielt werden, ebenso wie Zusatzinformationen zu Personen oder Kunstwerken.
Der Zukunftsforscher Ian Pearson erwartet sich zum Beispiel schon im nächsten Jahrzehnt elektronische Kontaktlinsen, die so gut sind wie unser Auge und uns bald übernatürlich detailliert wie durch ein Mikroskop sehen lassen. Durch Gedanken gesteuerte Prothesen könnten unseren Spielraum über unsere biologischen Körpergrenzen hinweg ebenso ausdehnen, ein Gehirnimplantat lässt uns dann vielleicht Vornamen von Gesprächspartnern nie wieder vergessen, weil sie über eine Art sozialen Datenstrom eingespielt werden, ebenso wie Zusatzinformationen zu Personen oder Kunstwerken.
Die einen nennen solche Visionen „Transhumanismus“, die anderen „Upgrade-Gesellschaft“. In jedem Fall geht es darum, sich mit technologischen Erweiterungen von anderen Menschen abzusetzen und ihnen „einen Schritt voraus“ zu sein, wenn nötig mit einer Beinprothese aus Karbon. Nebeneffekt: die, die sich solche funktionellen Körpererweiterungen nicht leisten können, können gesellschaftlich nicht mehr mitspielen. So wie für den Technikpsychologen Bertolt Meyer derzeit in der Bildung Menschen zurückgelassen werden. Wem dann die richtige Handprothese für einen diffizilen Reparaturjob fehlt, wird sich eine andere Arbeit suchen müssen – nicht mangels Fähigkeiten, sondern mangels Hardware. So geht das, wenn das Leben nur mehr als permanenter Gladiatorenkampf verstanden wird.
Zweifellos besteht das menschliche Projekt darin, sich aus der Abhängigkeit von der Natur zu lösen. Aber sich stattdessen von technologischen Lösungen abhängig zu machen? Glücklicherweise können wir selbst entscheiden, wie weit Technik – wortwörtlich – „in unser Leben eindringen“ kann. Denn verglichen mit der Aussicht auf superfunktionale Prothesen wirkt das Testosteron-Doping der Antike fast charmant.
Noten für die Bürger
(aus: Ö1-GEHÖRT, Jänner 2018)
Sie bestellen online immer wieder eine bestimmte Whisky-Sorte und unterschreiben gegen den Bau einer Hochgeschwindigkeitstrasse in der Nähe ihrer Wohnung: ganz schlecht. Dafür bekommen Sie nämlich Schlechtpunkte, als Krypto-Alkoholiker und Modernisierungsverweigerer.
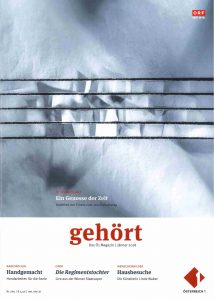 Das ist keine Fiktion. Zumindest nicht in China. Dort will man bis 2020 ein verpflichtendes Bürgerbewertungssystem nach Punkten einführen, einen „Citizen Score“, der alle Aktivitäten von Menschen bemisst – vom Online-Einkauf über ihr Verhalten in Sozialen Netzwerken bis hin zu ihrem Familienstatus. Und wer sich richtig brav benimmt, bekommt leichter Visa für Reisen ins Ausland und kann so etwa nach Singapur reisen.
Das ist keine Fiktion. Zumindest nicht in China. Dort will man bis 2020 ein verpflichtendes Bürgerbewertungssystem nach Punkten einführen, einen „Citizen Score“, der alle Aktivitäten von Menschen bemisst – vom Online-Einkauf über ihr Verhalten in Sozialen Netzwerken bis hin zu ihrem Familienstatus. Und wer sich richtig brav benimmt, bekommt leichter Visa für Reisen ins Ausland und kann so etwa nach Singapur reisen.
China ist aber nicht so weit weg, wie wir glauben möchten. Hinter der Idee des Citizen Score steckt ein zutiefst westliches Mantra, das aus den Allmachtsphantasien des Silicion Valley geboren wurde: der Glaube, man könne Menschen und Demokratie berechenbar machen und zumindest Letzteres durch Big Data ersetzen. Big Data: das sind riesige Datenmengen, die wir einfach dadurch erzeugen, dass wir leben – mit Einkäufen, mit Online-Bestellungen, bei Zahlungen mit der Kreditkarte oder durch das Handy. Big Data macht eine ganz andere Form von Statistik möglich als früher. Sie wird schon jetzt für Werkzeuge wie Predictive Policing benutzt. Diese Algorithmen werfen aus, an welchem Tag wo voraussichtlich ein Verbrechen passieren wird. Den Extremfall schildert Philip K. Dick in einer Kurzgeschichte, die später zum Film „Minority Report“ wurde: Da wird ein Mann frühmorgens verhaftet, weil er aufgrund der Berechnung einer Maschine einen Mord begehen wird.
Abgesehen davon, dass Daten immer nur einen kleinen, fragwürdigen Weltausschnitt darstellen, ist die Idee, unsere Zukunft Algorithmen zu übertragen, auch ein unglaublicher Misstrauensantrag an den Menschen als soziales Wesen. Big Data würde zum Beispiel eine Korrelation herstellen zwischen geringer Bildungsbeteiligung und geringem Einkommen. Menschliche Politik würde dieses Manko zu korrigieren versuchen, eine Maschine nicht.
Manche befürchten schon eine Datendiktatur, den heraufziehenden technologischen Totalitarismus. Denn wenn Daten mehr zählen als der Mensch, ist es mit dem Menschlichen bald nicht mehr weit her.