Lasst uns doch müde sein!
(aus: Ö1-GEHÖRT, Dezember 2018)
 Freund Ulrichsberger ist Anwalt. Er hatte mit der digitalen Welt bislang nicht sehr viel am Hut. Seit er ein Heavy-Duty-Handy hat – im Grunde ein unverwüstliches Smartphone für Baggerfahrer – ist vieles anders. Jetzt beantwortet er ab und zu schon SMS und interessiert sich für originelles elektronisches Spielzeug. Zuletzt rief er mich an, weil ich von einem „smarten System“ berichtet hatte, das Angestellte mit kalter Luft anbläst, sobald sie im Begriff sind, einzuschlafen. Das steigert die Produktivität. Denn in der Leistungsgesellschaft schickt es sich einfach nicht, müde, geschweige denn erschöpft zu sein. Aber was tut Ulrichsberger? – Er will die Gerätschaft aus Japan nicht für seine Mitarbeiter anschaffen, sondern für sich selbst – wenn er bei Gericht mit der Müdigkeit kämpft, rein zum Selbstschutz.
Freund Ulrichsberger ist Anwalt. Er hatte mit der digitalen Welt bislang nicht sehr viel am Hut. Seit er ein Heavy-Duty-Handy hat – im Grunde ein unverwüstliches Smartphone für Baggerfahrer – ist vieles anders. Jetzt beantwortet er ab und zu schon SMS und interessiert sich für originelles elektronisches Spielzeug. Zuletzt rief er mich an, weil ich von einem „smarten System“ berichtet hatte, das Angestellte mit kalter Luft anbläst, sobald sie im Begriff sind, einzuschlafen. Das steigert die Produktivität. Denn in der Leistungsgesellschaft schickt es sich einfach nicht, müde, geschweige denn erschöpft zu sein. Aber was tut Ulrichsberger? – Er will die Gerätschaft aus Japan nicht für seine Mitarbeiter anschaffen, sondern für sich selbst – wenn er bei Gericht mit der Müdigkeit kämpft, rein zum Selbstschutz.
So ist die Technologie. Immer janusköpfig.
Die Leistungskontrolle bei Arbeitnehmerinnen und –nehmern scheint jedenfalls zu boomen. Forscher einer amerikanischen Universität haben eine App entwickelt, die die Wachsamkeit der Nutzer über die Augen misst. Immer, wenn man sein Handy entsperrt, nimmt es ein Foto der Pupille auf und analysiert es. Postwendend teilt die App dann mit, ob der Energielevel gesunken ist. Dabei kommt den Entwicklern auch zugute, dass Menschen im Schnitt rund 90mal pro Tag das Smartphone in die Hand nehmen. Ob das Handy bei sinkender Energie Stromschläge austeilt, ist aus dem Beipackzettel nicht zu erschließen. Ich warte aber nur noch darauf, dass auch der Lohn an die Messwerte der App angepasst wird.
Eine Münchner Firma geht noch einen Schritt weiter. Sie hat ein Eyetracking-System zusammengebaut, das unten an den Monitor geklemmt wird. Damit lassen sich die Augen wie eine Computermaus nutzen. Wenn Designer etwa das Gehäuse eines Haushaltsgeräts entwerfen, legen sie mit ihrer Maushand oft weite Strecken zurück. Lässt man sie jetzt mit dem Auge klicken, erspart das 30-45 Minuten pro Tag. Oder ganz privat: Mit Eyetracking kann man seine Emails beim Frühstück mit den Augen löschen, ohne sein Croissant fallen lassen zu müssen.
Mein Freund Ulrichsberger verweigert derartige Optimierungsorgien glücklicherweise. Aber er hat mir gestanden, er warte nur mehr darauf, dass ein „findiger“ Kopf als nächstes die Ohren als Arbeitsgeräte entdeckt. Denn die hätten sich jetzt wirklich lange genug als Leistungsverweigerer profiliert.
Porno-Boom
(aus: Ö1-GEHÖRT, November 2018)
Wenn Sie das Netz vor allem für Wikipedia oder Twitter nutzen, dann gehören Sie zu einer Minderheit. Oder Sie schummeln. Die Mehrheit schaut im Netz nach Pornoseiten. Das behauptet zumindest eine Studie von SimilarWeb. Das IT-Unternehmen erstellte für Deutschland eine Liste der beliebtesten Online-Portale, gemessen an der Zeit, die die Nutzer dort verbringen.
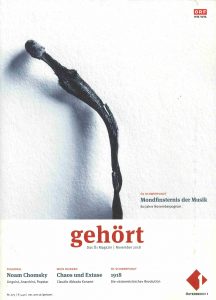 Ähnlich ist die Situation in den USA. Dort liegen vier Pornowebseiten unter den Top-20. Sie sind damit populärer als der Bezahldienst Paypal oder das Berufsnetzwerk LinkedIn.
Ähnlich ist die Situation in den USA. Dort liegen vier Pornowebseiten unter den Top-20. Sie sind damit populärer als der Bezahldienst Paypal oder das Berufsnetzwerk LinkedIn.
Das hat auch etwas Positives, könnte man meinen: Wenn Menschen mehr Pornos schauen, verbringen Sie weniger Zeit damit, Hasskommentare und Schmuddelgeschichten in Sozialen Medien abzusondern.
Aber so einfach ist die Sache leider nicht. Wie eine Untersuchung der Indiana State University belegt, werden die Online-Porno-Konsumenten immer jünger. So sollen bereits 13jährige Buben und 14jährige Mädchen, zumindest in den USA, regelmäßig Sexfilmchen im Netz ansehen. Der anatomische Lerneffekt dürfte dabei sehr beschränkt sein. Nicht so die Kollateralschäden, die das weltfremde Kunstgerammle bei denen anrichtet, die gerade erst das sexuelle Leben entdecken und von den artifiziellen Geschlechtsakten (falsch) geprägt werden. Die Instant-Befriedigung der Online-Sexfilme vermittelt keinen Hauch von Intimität, die für ein gleichermaßen spannendes wie entspanntes Sexleben notwendig ist. Sex wird zum schnell konsumierbaren Gebrauchsgut und schmeckt bald so intensiv wie schaler Automatenkaffee.
Die deutsche Sexualtherapeutin Heike Melzer sieht in den Online-Pornos entsprechend wenig Befreiendes, wie Spätachtundsechziger vielleicht meinen könnten, sondern viel mehr Einschränkendes. (Junge) Leute bekommen eine völlig falsche Vorstellung von gemeinsamer Körperlichkeit. Die Folge: In Melzers Praxis tauchen zunehmend jüngere Patienten auf, mit dem Smartphone in der linken und Viagra in der rechten Hand.
Na bravo.
Vielleicht haben manche das Sprachbild vom „Verkehr auf der Datenautobahn“ echt missverstanden.
Alltagshacker
(aus: Ö1-GEHÖRT, Oktober 2018)
Halmer ist ein militanter Verfechter der Rasenkultur. Läge sein Grundstück nicht am Hang, man könnte darauf prima Tennis spielen. Nun aber hat sich Halmer einen Rasenmäher-Roboter angeschafft. Statt von der Terrasse aus den kleine Sensenmann zu beobachten, läuft Halmer oft stundenlang in meditativer Geschwindigkeit nahe null hinter dem Roboter her. Und das nur, weil der autonome Rasenmäher anfangs ein paarmal irgendwo hängen blieb und dann um Hilfe piepste.
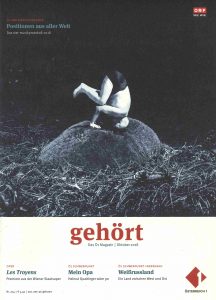 In diesem Fall hat die Maschine dem Menschen ihren „Willen“ aufgezwungen. Glücklicherweise passiert es viel öfter, dass sich Menschen über den vordergründigen Maschinenzweck hinwegsetzen und sich quasi von der Knebelung der Maschine emanzipieren. Freund Ulrichsberger, der ob seines originellen psychischen Korsetts an dieser Stelle schon öfter Erwähnung fand, wusch zum Beispiel zu Studienzeiten einen Teil seiner Wäsche im Geschirrspüler. Von bakteriologischen Nebenwirkungen bei seinen WG-Genossen ist glücklicherweise nichts bekannt.
In diesem Fall hat die Maschine dem Menschen ihren „Willen“ aufgezwungen. Glücklicherweise passiert es viel öfter, dass sich Menschen über den vordergründigen Maschinenzweck hinwegsetzen und sich quasi von der Knebelung der Maschine emanzipieren. Freund Ulrichsberger, der ob seines originellen psychischen Korsetts an dieser Stelle schon öfter Erwähnung fand, wusch zum Beispiel zu Studienzeiten einen Teil seiner Wäsche im Geschirrspüler. Von bakteriologischen Nebenwirkungen bei seinen WG-Genossen ist glücklicherweise nichts bekannt.
Auf der Seite ikeahackers.net finden sich mehr als 5.000 Anleitungen, wie man Geräte der schwedischen Möbelschleuder zweckentfremden und etwa einen Kindertisch zu einem Biotop für Sukkulenten umbauen kann. Das nenn ich mal Aneignung von Technik, statt sich ihr passiv zu unterwerfen, wie wir es im Alltag fast immer tun. (Die Spezialisten sprechen dabei von Life Hacks.) Mittlerweile hat sich etwa eine eigene Design-Szene rund um Euro-Paletten entwickelt, die Betten genauso daraus baut wie Regale, Sitzmöbel oder Fahrradständer.
Originell finde ich auch die Zubereitung von quasi-pochierten Eiern im Filter einer Kaffeemaschine, auch wenn ich es (noch) nicht probiert habe. Wobei sich Hacks in der Küche generell großer Beliebtheit erfreuen. Der Wirt im Ort bügelte früher bei Caterings Zanderfilets zwischen Butterpapier gar, statt sie auf der heißen Platte zu braten. Und bei größerem Obstanfall schält die Minderheit in der Familie – also die Buben und ich – die Äpfel mit Hilfe des Akkuschraubers.
Nicht immer muss ein Life Hack funktionieren. Als der Große noch klein war, telefonierte er gerne mit der Oma. Einmal war sie um die Welt nicht zu erreichen. Er hatte nämlich die Fernbedienung für das TV-Gerät erwischt.
FOMO
(aus: Ö1-GEHÖRT, September 2018)
Stünde Schnittlauchlocke im Berufsleben: man könnte ihn mit Fug und Recht als Multifunktionär bezeichnen. Neben Fußball in drei Mannschaften geht unser 9jähriger auch noch anderen Sportarten nach oder spielt Gitarre. Nicht, weil ihn jemand dazu zwingen würde. Es entspricht seiner Betriebstemperatur. Er ist einfach rührig. Jüngst stand er wieder einmal mit hängenden Schultern da, weil ein Fußballspiel, bei dem er sich unabkömmlich wähnte, zur selben Zeit stattfand wie eine Geburtstagsfeier und eine Poolparty. Und er wollte nichts davon auslassen.
 „Fear of Missing Out“ nennt sich die Befürchtung, man könnte irgendetwas versäumen. Seit 2013 steht diese Angst mit ihrem Akronym FOMO sogar im Oxford Dictionary. Natürlich dank sozialer Medien. Denn die ständige Beschallung mit dem Leben anderer verstärkt solche Versäumnisgefühle sogar noch. Es muss ja einen Grund haben, warum Menschen im Schnitt 75mal pro Tag auf ihr Smartphone schauen.
„Fear of Missing Out“ nennt sich die Befürchtung, man könnte irgendetwas versäumen. Seit 2013 steht diese Angst mit ihrem Akronym FOMO sogar im Oxford Dictionary. Natürlich dank sozialer Medien. Denn die ständige Beschallung mit dem Leben anderer verstärkt solche Versäumnisgefühle sogar noch. Es muss ja einen Grund haben, warum Menschen im Schnitt 75mal pro Tag auf ihr Smartphone schauen.
Wie Manfred Poser in seinem Buch #fomo schreibt, gaben bei einer Befragung von mehr als 1000 Menschen mit einem Durchschnittsalter von 28 Jahren immerhin 28 Prozent an, lieber auf Sex verzichten zu wollen als auf ihr Handy.
Dabei ist das strahlende Leben der Anderen, an dem wir über Facebook, Instagram oder Snapchat Anteil haben, ein Trugbild. Es ist eine Abfolge wirklicher oder inszenierter Höhepunkte, eine Abfolge von Hochglanzmomenten in der ganz alltäglichen Timeline, vom außergewöhnlichen Sonnenuntergang vor Koh Samui bis zur gelungenen Paella am Gasring in der Outdoor-Küche. Von den langen Zeiten zwischen diesen raren Vorzeigemomenten, den Strapazen des Reisens oder den verbrannten Töpfen, erfahren wir in der Regel nichts in den sozialen Medien. Wohl deshalb unterliegen wir vielfach der Zwangsvorstellung, das Leben würde andernorts stattfinden, getreu dem Motto „Das Glück ist immer dort, wo ich nicht bin.“
Manche bezeichnen FOMO, die Angst etwas zu versäumen, auch als technologie-induzierten Weltschmerz. Soweit ist es bei Schnittlauchlocke noch nicht. Er verlangt glücklicherweise noch nicht nach einem Smartphone und Zugang zum weltweiten Basar der Eitelkeiten. Deshalb muss ich ihm auch nicht nahelegen, auf https://psychcentral.com/quizzes/fomo-quiz/ zu testen, ob er schon unter Social Media-FOMO leidet.
Patschen-Museen
(aus: Ö1-GEHÖRT, August 2018)
Kürzlich bin ich in das frühe 19. Jahrhundert gereist, an den Fuß des Pasterzen-Gletschers unter dem Großglockner. Der hat sich vor knapp 200 Jahren wirklich noch weit ins Tal gestreckt. Der Landschaftsmaler Thomas Ender hat die Pasterze in Öl dokumentiert. Die Salzburger Residenz-Galerie zeigt das Gemälde nicht nur physisch, sondern auch in einer Online-Ausstellung. (Trump würde das Bild für ein Fake der Klimawandel-Apologeten halten, aber was macht das schon.)
 Ich bin mittlerweile ein Fan von Museumsbesuchen via Netz – nicht nur, wenn das Wetter gerade auslässt und ich am Wochenende einfach zu müde bin, um noch etwas zu unternehmen. Eine meiner liebsten Adressen ist die Europeana. Derzeit zeigt dieses europäische Projekt u.a. berührende Postkarten aus dem ersten Weltkrieg. Abgesehen von solchen Spezialausstellungen, etwa in Zusammenarbeit mit der Österr. Mediathek über österr. Exil-Komponisten wie Erich Wolfgang Korngold, bietet die Europeana rund eine halbe Million weiterer Exponate – ein Schlaraffenland für Reisende, die mehr auf geistige als physische Mobilität setzen.
Ich bin mittlerweile ein Fan von Museumsbesuchen via Netz – nicht nur, wenn das Wetter gerade auslässt und ich am Wochenende einfach zu müde bin, um noch etwas zu unternehmen. Eine meiner liebsten Adressen ist die Europeana. Derzeit zeigt dieses europäische Projekt u.a. berührende Postkarten aus dem ersten Weltkrieg. Abgesehen von solchen Spezialausstellungen, etwa in Zusammenarbeit mit der Österr. Mediathek über österr. Exil-Komponisten wie Erich Wolfgang Korngold, bietet die Europeana rund eine halbe Million weiterer Exponate – ein Schlaraffenland für Reisende, die mehr auf geistige als physische Mobilität setzen.
Ein paar Klicks weiter schrumpft die Welt zu einer kleinen Kugel, halb so groß wie jetzt. Der Indische Ozean ist ein Binnenmehr, Skandinavien wirkt richtiggehend zerfleddert, und im Zentrum des Globus liegt Jerusalem: so gesehen auf einer Online-Weltkarte aus dem Jahr 1485, 7 Jahre bevor Amerika Platz auf den Karten zu beanspruchen begann. Zu finden sind historische Kartenblätter hochaufgelöst in der Online-Präsentation der Sammlung Woldan. (Die Wieder-Weltkarte hat übrigens auch das Paradies eingezeichnet – es liegt ganz am Rand, am äußersten Ende von Asien, und wird vom Tigris mit Wasser versorgt, falls wer danach sucht.)
Ein paar Jahrhunderte später stirbt der bürgerliche Kleidermacher, Franz Rabensteiner, im Salzburger Bürgerspital, 63 Jahre alt, an Auszehrung. Das entnehme ich dem Salzburger Intelligenzblatt vom 9. August 1806. Auch historische Zeitungen wie diese sind im Netz zu finden, im virtuellen Lesesaal der Österr. Nationalbibliothek.
Und wer gern in die jüngere akustische Vergangenheit eintaucht, um zum Beispiel eine analoge Schreibmaschine samt Klingelton am Ende der Zeile zu hören: dem empfehle ich conservethesound.de. Dort ist auch das Rattern eines Wählscheibentelefons zu finden. Schnittlauchlocke, meinem 9jährigen Sohn, musste ich übrigens erst erklären, wozu man diese Dinger früher nutzte.
Die Kürze der Ewigkeit
(aus: Ö1-GEHÖRT, Juli 2018)
Ulrich erlebte jüngst sein Daten-Waterloo. Er hatte vor etwa 15 Jahren das filmische Vermächtnis der Familie von 8mm-Farbfilm auf einige DVDs umkopieren lassen. Als Kinder hatten wir uns vor Lachen gebogen, wenn sein Vater die Filme rückwärts laufen ließ und Ulrich aus dem Wasser wieder auf das Drei-Meter-Brett zurück flog oder mit den Sohlen voran aus den Fluten vor Jesolo auftauchte und wieder trocken ins Boot sprang.
 Diese Familiengeschichte ist nun verloren, weil die DVDs kaputt sind. Entweder er hatte sie zu warm gelagert oder sie haben sich ganz natürlich zersetzt. So genau weiß das niemand. Natürlich hatte Ulrich die Filmbänder nach dem Umkopieren entsorgt. Weil digital ist ja gleichbedeutend mit ewig, dachte er.
Diese Familiengeschichte ist nun verloren, weil die DVDs kaputt sind. Entweder er hatte sie zu warm gelagert oder sie haben sich ganz natürlich zersetzt. So genau weiß das niemand. Natürlich hatte Ulrich die Filmbänder nach dem Umkopieren entsorgt. Weil digital ist ja gleichbedeutend mit ewig, dachte er.
Das erinnert mich an den Beginn der CDs. Die wurden anfangs auch mit ihrer ewigen Haltbarkeit angepriesen. Schnell schrumpfte diese Ewigkeit aber auf ein paar Jahre. Das merkte man vor allem dann, wenn die Lieblings-CD nach ein paar Jahren nur mehr mit unschönen Rucklern und elektronischen Klicksern abspielbar war.
Noch schlimmer ist es um die Haltbarkeit von Festplatten bestellt. Im Mittel überleben sie nur rund 5 Jahre. Manche geben schon nach 2 Jahren ihren Geist auf. Das hat in meiner Datenverlust-Paranoia dazu geführt, dass ich die tausenden Familienfotos, zu denen jedes Jahr eine vierstellige Anzahl dazu kommt, mittlerweile auf vier Festplatten sichere. Einmal habe ich übrigens in die falsche Richtung gesichert und damit einen Teil der Geschichte gelöscht.
Moderne Speichermedien wie die M-Disc oder die Archival Disc sollen übrigens 1000 Jahre halten. Diese Versprechen erinnern fatal an die anfänglichen Ewigkeitsprognosen rund um die CD.
Aber auch moderne analoge Speichermedien sind vom Zahn der Zeit nicht verschont. Bücher mit säurehaltigem Papier aus Holz überleben meist nur wenige Jahrzehnte. Das Lumpenpapier auf Leinenbasis, auf dem Gutenberg druckte, war weitaus haltbarer.
Wenn Ulrich heuer aus dem Urlaub zurückkommt, wird er seine Fotos und Filme mindestens zweifach sichern, hat er gemeint, vielleicht sogar in der Cloud. Eines wird er auf jeden Fall lernen: wie ein wirklich gutes Speichermedium aussieht. Er fährt nämlich nach Ägypten zu den in Stein gemeißelten Hieroglyphen.
Die Muße ist analog
(aus: Ö1-GEHÖRT, Juni 2018)
Nein, die 50. Kolumne wird kein kulturpessimistisches Geraunze über das Handy und auch kein rituelles Tech-Bashing. Aber…
Das Aber kommt später.
 Ich gestehe zuerst einmal: Ich nutze das Smartphone gerne als russische Fellhaube. Wenn ich in der U-Bahn oder im Zug sitze, dann stülpe ich es mir via Kopfhörer über, damit ich die trostlosen Privatheiten meiner Umgebung nicht mitanhören muss. Manchmal nehme ich nur die Kopfhörer und schließe sie nicht mal an. Von wegen Kommunikation: Ich komme sowieso nur in Ausnahmefällen auf die Idee, mit Wildfremden zu reden.
Ich gestehe zuerst einmal: Ich nutze das Smartphone gerne als russische Fellhaube. Wenn ich in der U-Bahn oder im Zug sitze, dann stülpe ich es mir via Kopfhörer über, damit ich die trostlosen Privatheiten meiner Umgebung nicht mitanhören muss. Manchmal nehme ich nur die Kopfhörer und schließe sie nicht mal an. Von wegen Kommunikation: Ich komme sowieso nur in Ausnahmefällen auf die Idee, mit Wildfremden zu reden.
Ich schätze auch den allzeit bereiten Fotoapparat in meiner Hosentasche und die allgegenwärtigen Stadtpläne, wenn das Navi im äußersten Mühlviertel wieder mal mitten in den Feldern den Dienst versagt.
Auch die Warnung vor den gehässigen Pollen ist mir willkommen und die Online-Radiothek, die ich ständig mit mir herumtrage. Es gibt so vieles, was man am Mini-Computer mit Telefonfunktion loben könnte.
Aber: Das Smartphone hat uns die Muße geraubt.
Das wurde mir jüngst in der vollbesetzten Bahn bewusst, als ich gerade erschöpft vor mich hinstarrte und rings um mich nur nervös tippende oder wischende Finger sah und Hände, die sich um kleine schwarze Dinger klammerten. Die Muße: das ist die zwecklose Zeit im besten Sinn, jene Zeit, die – eventuell begleitet von einem trostlosen Blicks ins Nirgendwo – Neues Gebären kann, in der man vielleicht auch mal sein Leben in Frage stellt oder entscheidet, zu Neuem aufzubrechen. Muße ist zu einem raren Gut geworden, weil wir ständig beschäftigt sind mit unseren Smartphone-Prothesen, weil uns der Kommunikations-Knüppel mit seiner Instantbefriedigung von Bedürfnissen, die wir früher nie hatten, so in seinen Bann zieht.
Funktioniert auch bei mir, keine Frage. Und vor allem sieht man alle Untugenden an anderen viel besser als an sich selbst. Aber wenn man das Smartphone mal weglegt und kurze Zeit unbeschäftigt ist, beginnt der Kopf, Grundlagenforschung zu betreiben. Dabei schaut bekanntermaßen nicht immer etwas Brauchbares raus. Ohne Muße hingegen hat man garantiert keine neuen Ideen.
Jetzt weiß ich was: Vielleicht sollte ich eine Muße-App erfinden!
War nur ein Scherz.
Trügerische Bilder
(aus: Ö1-GEHÖRT, Mai 2018)
Die digitale Welt riecht nicht. Schade eigentlich. Die Nase ist nämlich unser unbestechlichster Sinn und lässt sich am wenigsten täuschen. Ganz anders als das Auge. Was wir sehen, gilt schnell einmal als wahr.
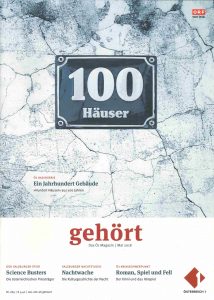 Aber gerade in Sachen Bildlichkeit scheint sich jede Vertrauenswürdigkeit in Luft aufzulösen, dank Bildbearbeitung und Künstlicher Intelligenz. Im Herbst zeigten ein paar verhaltensoriginelle Bastler, was mit Hilfe guter Software möglich ist: Sie tauschten die Gesichter von Pornodarstellern bei der Arbeit gegen jene von Berühmtheiten aus und deponierten die Schmuddelfilmchen auf diversen Webseiten. Auf den ersten Blick war der Schwindel nicht zu erkennen. Und natürlich verbreiteten sich die Videos so rasant, dass selbst die Anbieter einschlägiger Seiten die Notbremse zogen und die Fake Pornos – im Rahmen einer neu geschaffenen anti-face-swap porn policy – von ihren Portalen verbannten. Die optische Erschütterung ging unter dem Stichwort deepfakes in die Geschichte der Künstlichen Intelligenz und des Internets ein.
Aber gerade in Sachen Bildlichkeit scheint sich jede Vertrauenswürdigkeit in Luft aufzulösen, dank Bildbearbeitung und Künstlicher Intelligenz. Im Herbst zeigten ein paar verhaltensoriginelle Bastler, was mit Hilfe guter Software möglich ist: Sie tauschten die Gesichter von Pornodarstellern bei der Arbeit gegen jene von Berühmtheiten aus und deponierten die Schmuddelfilmchen auf diversen Webseiten. Auf den ersten Blick war der Schwindel nicht zu erkennen. Und natürlich verbreiteten sich die Videos so rasant, dass selbst die Anbieter einschlägiger Seiten die Notbremse zogen und die Fake Pornos – im Rahmen einer neu geschaffenen anti-face-swap porn policy – von ihren Portalen verbannten. Die optische Erschütterung ging unter dem Stichwort deepfakes in die Geschichte der Künstlichen Intelligenz und des Internets ein.
Diese Art Manipulation scheint nur eine konsequente Weiterführung der fast schon altmodisch anmutenden Photoshop-Retuschen von Bildern. Ein befreundeter Fotograf erzählte mir kürzlich, dass das Behübschen von Porträts auf Wunsch der Auftraggeber mittlerweile schon mehr Zeit einnehme als das Fotografieren selber. Aber trotzdem lassen sich Menschen noch immer von den künstlichen Model-Looks deprimieren.
Und selbst die Wissenschaft hat sich die Möglichkeiten der Bildmanipulation längst zu Eigen gemacht: Wann immer wir glänzende, blau und rot funkelnde Bilder des Universums präsentiert bekommen, sind dies keine Fotografien. Es sind Bilder, die aus den Daten von Teleskopen und Sondern generiert wurden, kulturelle Interpretationen und/ oder PR-Materialien, die mit der optischen Wirklichkeit des Weltalls nur bedingt zu tun haben.
Wobei mir die fotografische Treffsicherheit bei der Abbildung des Kosmos am wenigsten Sorgen macht. Vielmehr sorge ich mich darum, wie sehr wir digitalen Bildern noch glauben dürfen. Und wie ihre quasi-perfekte Manipulierbarkeit auch populistisch missbraucht werden kann. Vom Gedanken, dass ein Bild die Wirklichkeit so wiedergibt, wie wir das von der analogen Fotografie kennen, müssen wir uns jedenfalls verabschieden.
Wunderwörter
(aus: Ö1-GEHÖRT, April 2018)
Wörter sind wie Elixiere. Sie machen uns stark für die Zukunft oder befreien uns von Leiden der Gegenwart. Und manchmal sind sie auch ein bissl giftig. Aber das merkt man auf den ersten Blick nicht.
 Die Technik- und IT-Branche hat ein besonderes Talent, uns ihre Elixiere in schöner Wortverpackung zu verkaufen. Zu den Wunderessenzen, die momentan in aller Munde sind, gehört die Blockchain. Das dezentrale Vertrags- und Bezahlsystem, auf dem auch die virtuelle Währung Bitcoin beruht, wird unseren Umgang mit Abrechnungen und Abmachungen aller Art tatsächlich revolutionieren. Aber als Normalsterblicher hat man den Eindruck, dass man bald nicht mal mehr eine Semmel ohne Blockchain kaufen kann. Das Wort ist zu einem glänzenden Verkaufsargument jenseits seiner ureigenen Bedeutung geworden, einer riesigen Geldeinspielmaschine für Börsengänge, die sich nun ICOs – Initial Coin Offerings – nennen. Es sollen sich sogar Börsenkurse von Unternehmen aus der „old economy“ innerhalb kürzester Zeit verdoppelt haben, wenn sie sich das Wunderwort Blockchain umhängten.
Die Technik- und IT-Branche hat ein besonderes Talent, uns ihre Elixiere in schöner Wortverpackung zu verkaufen. Zu den Wunderessenzen, die momentan in aller Munde sind, gehört die Blockchain. Das dezentrale Vertrags- und Bezahlsystem, auf dem auch die virtuelle Währung Bitcoin beruht, wird unseren Umgang mit Abrechnungen und Abmachungen aller Art tatsächlich revolutionieren. Aber als Normalsterblicher hat man den Eindruck, dass man bald nicht mal mehr eine Semmel ohne Blockchain kaufen kann. Das Wort ist zu einem glänzenden Verkaufsargument jenseits seiner ureigenen Bedeutung geworden, einer riesigen Geldeinspielmaschine für Börsengänge, die sich nun ICOs – Initial Coin Offerings – nennen. Es sollen sich sogar Börsenkurse von Unternehmen aus der „old economy“ innerhalb kürzester Zeit verdoppelt haben, wenn sie sich das Wunderwort Blockchain umhängten.
Besonders giftig finde ich sharing economy. In einer Zeit, in der weniger geteilt wird denn je, gaukelt uns der Begriff eine Lawine an Altruismus vor, die diametral von seiner wahren Bedeutung entfernt ist. Sharing economy ist die Durchökonomisierung des Alltags, und das Wort stammt nicht durch Zufall aus der Gebärmutter des IT-gestützten Neoliberalismus, aus dem Silicon Valley. Nur weil man seine leerstehende Wohnung über AirBnB vermietet oder mit dem eigenen Fahrrad Essen für einen internationalen Konzern ausfährt, teilt man doch noch nicht. Als ich und meine Brüder in den 70er-Jahren aus unserem Kinderzimmer ausziehen mussten, damit unsere Eltern den Raum an Gäste vermieten konnten, war das nicht Teilen: Es war eine Einkommensquelle, halt nicht vermittelt über eine Plattform im Netz, sondern vom lokalen Tourismusbüro. Ganz entgegen meiner sonstigen Gewohnheit würde ich beim Teilen den Benchmark ganz traditionell beim Heiligen Martin ansetzen. Der hat seinen Mantel ohne Gegenleistung und ohne ein mitschneidendes CoatBnB geteilt.
Viel charmanter ist Hashtag. Er ist der Espresso des Internets. Weil er etwas (in einem Schlagwort) zu verdichten sucht. Was häufig nicht gelingt. Weshalb ich diese Kolumne kurz und bündig mit dem Hashtag schließe #Daswarjetztetwasdasichmirvonderseeleschreibenmusste.
Smarte Doppelmoral
(aus: Ö1-GEHÖRT, März 2018)
Ist Ihnen schon mal aufgefallen, wie wenig sich andere Menschen von ihrem Smartphone trennen können und wie oft sie im Hosentaschencomputer buchstäblich versinken? An der Bushaltestelle, vor einem Geschäft, im Pub, am Sportplatz. Und natürlich sind es immer nur die Anderen. Besonders schlimm ist die Smartphone-Abhängigkeit bei jungen Menschen. Das wurde mir jüngst bewusst, als ich über das Buch „Jetzt pack doch mal das Handy weg!“ von Thomas Feibel berichtete. Aus Übermut und weil ich mich über jegliche Vorwürfe erhaben fühlte, habe ich meinen 12jährigen Sohn zum Umgang seiner Eltern mit dem Handy interviewt.
Manno, da hat uns der Große aber die Leviten gelesen.
 Die Doppelmoral, der wir sogenannten Erwachsenen beim Umgang mit dem Smarthphone aufsitzen, lässt sich auf eine Handvoll Selbstlügen und Wirklichkeitsverbiegungen reduzieren, hier drei davon.
Die Doppelmoral, der wir sogenannten Erwachsenen beim Umgang mit dem Smarthphone aufsitzen, lässt sich auf eine Handvoll Selbstlügen und Wirklichkeitsverbiegungen reduzieren, hier drei davon.
Erstens: Wenn man selber auf das Handy sieht, ist das immer wichtiger, als wenn andere das tun. Wir beantworten nämlich ab und an ein berufliches Mail, während die anderen irgendwo im Netz rum hängen oder eines der sinnlosen Spiele zocken, von denen die Handywelt voll ist. Und wenn das eigene Smartphone beim Familienspiel bimmelt, muss man selbstverständlich nachschauen, während der Nachwuchs das Teufelszeug gefälligst liegen lassen soll.
Zweitens: Das Handy ist für viele mindestens so wichtig beim Gedeck wie Messer, Gabel und Löffel. Deshalb wird es auch rechts neben dem Teller aufgelegt, daheim und im Restaurant. Das verändert laut der amerikanischen Techniksoziologin Sherry Turkle die Gespräche am Tisch. Selbst bei ausgeschaltetem Handy oder verdecktem Display hören Menschen nicht so aufmerksam zu wie bei einem Essen ohne Smartphone.
Drittens: Das Smartphone ist ein wunderbares Werkzeug, um Kinder ruhig zu stellen. Quengeln sie bei einer langen Autofahrt oder werden sie im Gasthaus unruhig, während man sich noch unterhalten möchte, stopft man ihnen statt einem Schnuller in den Mund das Handy in die Hand. Und flugs geben sie Ruh. Soviel zur Vorbildwirkung und wie wir sie nicht erfüllen.
Seit dem Gespräch mit dem Großen versuchen wir uns immer wieder mit den Augen der Kinder zu sehen, wenn wir zum Smartphone greifen. Und wir fragen uns, ob wir es gut fänden, würden sie uns nachahmen. Die Antwort ist zwar nicht immer schön, aber hilfreich.
Digi-Doping
(aus: Ö1-GEHÖRT, Februar 2018)
Nur wenige Wochen, nachdem Arthur Linton 1896 das Rennen Bordeaux-Paris gewonnen hat, ist der Radrennfahrer tot. Er gilt als der erste Doping-Tote im Sport der Neuzeit. Sein Trainer hat ihm Spezialalkohol eingeflößt und damit sein Immunsystem zu sehr geschwächt. Schon in der Antike haben Sportler etwa mit Stierhoden experimentiert, um sich von Konkurrenten leistungsmäßig abzusetzen. Verglichen mit dem, was das dritte Jahrtausend an Leistungsverstärkern bieten wird, sind diese Mittel auf gut Wienerisch ein „Lercherl“.
 Der Zukunftsforscher Ian Pearson erwartet sich zum Beispiel schon im nächsten Jahrzehnt elektronische Kontaktlinsen, die so gut sind wie unser Auge und uns bald übernatürlich detailliert wie durch ein Mikroskop sehen lassen. Durch Gedanken gesteuerte Prothesen könnten unseren Spielraum über unsere biologischen Körpergrenzen hinweg ebenso ausdehnen, ein Gehirnimplantat lässt uns dann vielleicht Vornamen von Gesprächspartnern nie wieder vergessen, weil sie über eine Art sozialen Datenstrom eingespielt werden, ebenso wie Zusatzinformationen zu Personen oder Kunstwerken.
Der Zukunftsforscher Ian Pearson erwartet sich zum Beispiel schon im nächsten Jahrzehnt elektronische Kontaktlinsen, die so gut sind wie unser Auge und uns bald übernatürlich detailliert wie durch ein Mikroskop sehen lassen. Durch Gedanken gesteuerte Prothesen könnten unseren Spielraum über unsere biologischen Körpergrenzen hinweg ebenso ausdehnen, ein Gehirnimplantat lässt uns dann vielleicht Vornamen von Gesprächspartnern nie wieder vergessen, weil sie über eine Art sozialen Datenstrom eingespielt werden, ebenso wie Zusatzinformationen zu Personen oder Kunstwerken.
Die einen nennen solche Visionen „Transhumanismus“, die anderen „Upgrade-Gesellschaft“. In jedem Fall geht es darum, sich mit technologischen Erweiterungen von anderen Menschen abzusetzen und ihnen „einen Schritt voraus“ zu sein, wenn nötig mit einer Beinprothese aus Karbon. Nebeneffekt: die, die sich solche funktionellen Körpererweiterungen nicht leisten können, können gesellschaftlich nicht mehr mitspielen. So wie für den Technikpsychologen Bertolt Meyer derzeit in der Bildung Menschen zurückgelassen werden. Wem dann die richtige Handprothese für einen diffizilen Reparaturjob fehlt, wird sich eine andere Arbeit suchen müssen – nicht mangels Fähigkeiten, sondern mangels Hardware. So geht das, wenn das Leben nur mehr als permanenter Gladiatorenkampf verstanden wird.
Zweifellos besteht das menschliche Projekt darin, sich aus der Abhängigkeit von der Natur zu lösen. Aber sich stattdessen von technologischen Lösungen abhängig zu machen? Glücklicherweise können wir selbst entscheiden, wie weit Technik – wortwörtlich – „in unser Leben eindringen“ kann. Denn verglichen mit der Aussicht auf superfunktionale Prothesen wirkt das Testosteron-Doping der Antike fast charmant.
Noten für die Bürger
(aus: Ö1-GEHÖRT, Jänner 2018)
Sie bestellen online immer wieder eine bestimmte Whisky-Sorte und unterschreiben gegen den Bau einer Hochgeschwindigkeitstrasse in der Nähe ihrer Wohnung: ganz schlecht. Dafür bekommen Sie nämlich Schlechtpunkte, als Krypto-Alkoholiker und Modernisierungsverweigerer.
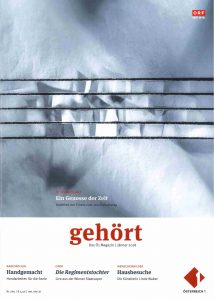 Das ist keine Fiktion. Zumindest nicht in China. Dort will man bis 2020 ein verpflichtendes Bürgerbewertungssystem nach Punkten einführen, einen „Citizen Score“, der alle Aktivitäten von Menschen bemisst – vom Online-Einkauf über ihr Verhalten in Sozialen Netzwerken bis hin zu ihrem Familienstatus. Und wer sich richtig brav benimmt, bekommt leichter Visa für Reisen ins Ausland und kann so etwa nach Singapur reisen.
Das ist keine Fiktion. Zumindest nicht in China. Dort will man bis 2020 ein verpflichtendes Bürgerbewertungssystem nach Punkten einführen, einen „Citizen Score“, der alle Aktivitäten von Menschen bemisst – vom Online-Einkauf über ihr Verhalten in Sozialen Netzwerken bis hin zu ihrem Familienstatus. Und wer sich richtig brav benimmt, bekommt leichter Visa für Reisen ins Ausland und kann so etwa nach Singapur reisen.
China ist aber nicht so weit weg, wie wir glauben möchten. Hinter der Idee des Citizen Score steckt ein zutiefst westliches Mantra, das aus den Allmachtsphantasien des Silicion Valley geboren wurde: der Glaube, man könne Menschen und Demokratie berechenbar machen und zumindest Letzteres durch Big Data ersetzen. Big Data: das sind riesige Datenmengen, die wir einfach dadurch erzeugen, dass wir leben – mit Einkäufen, mit Online-Bestellungen, bei Zahlungen mit der Kreditkarte oder durch das Handy. Big Data macht eine ganz andere Form von Statistik möglich als früher. Sie wird schon jetzt für Werkzeuge wie Predictive Policing benutzt. Diese Algorithmen werfen aus, an welchem Tag wo voraussichtlich ein Verbrechen passieren wird. Den Extremfall schildert Philip K. Dick in einer Kurzgeschichte, die später zum Film „Minority Report“ wurde: Da wird ein Mann frühmorgens verhaftet, weil er aufgrund der Berechnung einer Maschine einen Mord begehen wird.
Abgesehen davon, dass Daten immer nur einen kleinen, fragwürdigen Weltausschnitt darstellen, ist die Idee, unsere Zukunft Algorithmen zu übertragen, auch ein unglaublicher Misstrauensantrag an den Menschen als soziales Wesen. Big Data würde zum Beispiel eine Korrelation herstellen zwischen geringer Bildungsbeteiligung und geringem Einkommen. Menschliche Politik würde dieses Manko zu korrigieren versuchen, eine Maschine nicht.
Manche befürchten schon eine Datendiktatur, den heraufziehenden technologischen Totalitarismus. Denn wenn Daten mehr zählen als der Mensch, ist es mit dem Menschlichen bald nicht mehr weit her.