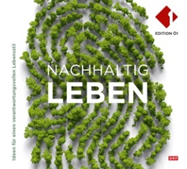„Milderung, Schadensbegrenzung, Abschwächung“: So etwa könnte man die deutsche Bedeutung des Wortes „mitigation“ umschreiben, das immer wieder im Umfeld von Strategien zur Bewältigung des Klimawandels fällt. Dieses Wort enthält ein gerüttelt Maß an Desillusionierung, vermittelt es doch, dass wir die Erderwärmung in absehbarer Zeit nicht mehr zurückschrauben können. Stattdessen müssen wir mit den Folgen umgehen lernen, uns anpassen, den Schaden begrenzen.
Wie ein in dieser Woche veröffentlichtes Papier der EU zeigt, hat sich Europa noch nicht ausreichend auf die laufenden und kommenden Veränderungen eingestellt. Und dies, obwohl Europa jener Kontinent ist, der sich weltweit derzeit am schnellsten erwärmt.
Extreme Hitze, Dürre, Waldbrände und Überschwemmungen, wie wir sie in den letzten Jahren erlebt haben, werden sich in Europa selbst in den optimistischen Szenarien der globalen Erwärmung verschlimmern und die Lebensbedingungen auf dem gesamten Kontinent beeinträchtigen, schreibt die Europäische Umweltagentur (EUA) in ihrer ersten Klimarisikobewertung und warnt vor „katastrophalen“ Folgen.
Die europäischen Strategien und Anpassungsmaßnahmen würden nicht mit den sich rasant verschärfenden Risiken Schritt halten, so die EUA. Das trifft selbst Bereiche, die jetzt noch nicht akut sind. Denn viele Maßnahmen zur Stärkung der Klimaresilienz brauchen viel Zeit. Verstreicht sie ungenutzt, sind wir irgendwann zu spät dran.
„Unsere neue Analyse zeigt, dass Europa mit dringenden Klimarisiken konfrontiert ist, die sich schneller entwickeln als unsere gesellschaftliche Vorsorge“, bringt die Direktorin der Umweltagentur, Leena Ylä-Mononen, die europäische Zögerlichkeit auf den Punkt.
Südeuropa etwa ist durch mehrere Klimarisiken gefährdet, durch Waldbrände gleichermaßen wie durch die Auswirkungen von Hitze und Wasserknappheit auf die Landwirtschaft. Auch die Arbeit im Freien und die menschliche Gesundheit leiden durch die Erderwärmung. „Überschwemmungen, Erosion und das Eindringen von Salzwasser bedrohen tief gelegene Küstenregionen Europas, darunter viele dicht besiedelte Städte.“
Allein in Griechenland reduzierten Waldbrände im Jahr 2023 die landwirtschaftliche Produktion um 15 Prozent. Mehr als 40 Milliarden Euro betrugen laut EU-Kommission die Schäden der Überflutungen 2021 in Deutschland und Belgien. Seit 1980 belaufen sich die Schäden der Klimaerwärmung in Europa auf 650 Milliarden Euro. Und die Umweltbehörde prognostiziert: 1.000 Milliarden Euro pro Jahr wird uns die Erderhitzung in Zukunft kosten, weil Ernten und Böden verloren gehen, weil sich Krankheiten ausbreiten, die man bisher nur von Fernreisen kannte, weil Steuereinnahmen sinken oder immer mehr und größere Schäden zu beseitigen sind.
Als Reaktion auf die Warnungen der EUA hat die EU-Kommission diese Woche einen Klimaaktionsplan präsentiert, dessen zentrale Maßnahmen hier nachzulesen sind.
Acht von 36 Klimarisiken beurteilt die Umweltagentur als „besonders dringlich“: Es gehe darum, „Ökosysteme zu erhalten, die Menschen vor Hitze zu schützen, Menschen und Infrastruktur vor Überschwemmungen und Waldbränden zu schützen und die Tragfähigkeit europäischer Solidaritätsmechanismen, beispielsweise des Solidaritätsfonds der Europäischen Union, zu sichern.“
Als ökologisch besonders bedroht gelten Meeres- und Küstenökosysteme. Aber auch an Land gilt: Intakte Ökosysteme sind effektive Puffer für Auswirkungen des Klimawandels. Verlieren sie diese Fähigkeit, besteht die Gefahr von Kaskadeneffekten auf Bereiche wie Ernährung, Gesundheit, Infrastruktur und Wirtschaft.
Insofern zahlt es sich aus, noch genauer auf den Erhalt von Ökosystemen zu schauen und all jene, die bereits gelitten haben, zu reparieren – so wie es die EU kürzlich mit dem Nature Restoration Law angeregt hat.
Um es ohne Blümchenromantik zu formulieren: Die Natur braucht uns nicht. Wir brauchen die Natur.
Schnellere Reduktion von Methanemissionen im Energiesektor notwendig
Methan I
Zum Schutz des Klimas müsse die Freisetzung von Methan bei der Öl- und Gasförderung deutlich sinken, warnt die Internationale Energieagentur (IEA) diese Woche.
Laut einem neuen Bericht der IEA seien 2023 knapp 120 Millionen Tonnen Methan bei der Förderung der beiden fossilen Energieträger freigesetzt worden – eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Dazu kamen rund zehn Millionen Tonnen Methan aus Bioenergiequellen wie der Nutzung von Biomasse. Die Hauptverursacher sind die USA, Russland und China.
Methan ist für fast ein Drittel des globalen Temperaturanstiegs seit der Industriellen Revolution verantwortlich und der Energiesektor die zweitgrößte Emissionsquelle aus menschlichen Aktivitäten.
Obwohl sich Methan in der Atmosphäre schneller verflüchtigt als Kohlendioxid, trägt es während seiner kurzen Lebensdauer viel stärker zur Erderwärmung bei. Daher sei die Senkung der Methanemissionen eine der besten Möglichkeiten, die globale Erwärmung zu begrenzen und die Luftqualität kurzfristig zu verbessern, so die IEA. Um die Klimaziele zu erreichen, ist bis 2030 eine Senkung des Methanausstoßes um 75 Prozent nötig.
Hielten sich die Staaten an ihre Zusagen auf der Weltklimakonferenz in Dubai im Dezember 2023, würde allein dies den Methanausstoß bis 2030 halbieren. Zudem sind Maßnahmen zur Reduktion von Methanemissionen kostengünstig oder sogar gewinnbringend, da sie den Verlust von wertvollem Erdgas vermeiden.
Weltweiter Methanausstoß höher als angenommen
Methan II
Bei der Förderung von Öl und Gas tritt etwa durch Lecks in den Leitungen deutlich mehr Methan ungenutzt in die Atmosphäre aus als bisher angenommen. Das legt eine neue Nature-Studie nahe. Eine Analyse von sechs Förderregionen in den USA zeigt, dass dort fast drei Prozent des geförderten Methans entweichen, dreimal mehr als die US-Regierung derzeit berücksichtigt.
Methan ist über 20 Jahre betrachtet rund 80-mal klimawirksamer als Kohlendioxid, bleibt allerdings nur 10 Jahre in der Atmosphäre. Obwohl Methan-Emissionen nur etwa drei Prozent des anthropogenen Treibhausgas-Ausstoßes ausmachen, haben sie bereits 0,5 Grad zur durchschnittlichen Erderwärmung beigetragen. „Geminderte Methan-Emissionen würden also vergleichsweise schnell klimawirksam. Etwa 40 Prozent der menschenverursachten Methan-Emissionen entstehen in der Energiewirtschaft“, wie das deutsche Science Media Center (SMC) schreibt. Zudem sind nur wenige der untersuchten Förderanlagen für die Hälfte der Methanemissionen verantwortlich, was effektive Gegenmaßnahmen erleichtern könnte. Den finanziellen Verlust für die fördernden Unternehmen schätzen die Forschenden auf über eine Milliarde US-Dollar, so das SMC.
Home | Science Media Center Germany
Wärmerekorde in den Weltmeeren
Seit einem Jahr nur mehr Höchstwerte
Bereits seit rund einem Jahr liegt die mittlere Oberflächentemperatur des Nordatlantiks an jedem einzelnen Tag auf dem höchsten Tagesstand seit Messbeginn vor rund 40 Jahren – meistens sogar mit einem großen Abstand zum bisherigen Tagesrekord. Das zeigen Daten der Plattform Climate Reanalyzer.
Die Tagesrekorde des Nordatlantiks begannen am 7. März 2023, in den Weltmeeren insgesamt starteten sie am 14. März.
„Wenn man sich anguckt, wie die Temperaturentwicklung in den Ozeanen der anderen 40 Jahre war, kann man sehen, dass die derzeitige Erwärmung wirklich weit außerhalb der natürlichen Schwankungen liegt“, sagt Anders Levermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK).
Das Great Barrier Reef etwa erlebt durch die hohen Wassertemperaturen gerade seine fünfte Korallenbleiche innerhalb von acht Jahren.
Die Plattform Climate Reanalyzer wird von der University of Maine betrieben, die Daten stammen unter anderem von Satellitenmessungen.
(Zum Teil wörtlich übernommen von science.orf.at)
https://science.orf.at/stories/3223939
Kurz gemeldet
Auf der indonesischen Insel Sulawesi ist es Forschenden gelungen, ein abgestorbenes Korallenriff innerhalb von nur 4 Jahren zu revitalisieren. Besonders die hohen Wassertemperaturen setzen den Korallen zu, wie etwa jetzt vor der Küste Australiens.
https://science.orf.at/stories/3223936
Die Arktis könnte im September, dem Höhepunkt des arktischen Sommers, in den nächsten Jahren eisfrei werden. Seit Beginn von Satellitenmessungen des Packeises im Jahr 1978 ist seine Fläche im Schnitt um 78.000 Quadratkilometer pro Jahr geschrumpft.
https://science.orf.at/stories/3223990
Tipps
Klima Biennale Wien
Vom 5. April bis zum 14. Juli findet die erste Klima Biennale Wien statt, ein interdisziplinäres Festival, das Kunst, Design, Architektur und Wissenschaft zum Thema Klimawandel verbindet. Mit mehr als 60 Partnern wird die ganze Stadt zur Bühne für kreative Lösungen und gesellschaftlichen Dialog. 100 Tage lang machen sich die unterschiedlichsten Disziplinen auf die Suche nach einer nachhaltig-lebenswerten Zukunft und beschäftigen sich gleichzeitig mit den gesellschaftlichen Auswirkungen des Klimawandels.
Die Biennale Zentrale ist im KunstHausWien untergebracht, das gerade nachhaltig saniert wurde. Bespielt werden aber auch der Projektraum Garage mit modularen Werkstätten, Repair-Cafés und Workshops oder ein Areal am Nordwestbahnhof.
Ausstellung: Klima.Wissen.Handeln
Eine neue Dauerausstellung im Technischen Museum in Wien versucht die Verbindung von Klimakrise und anderen großen Umweltthemen aufzuzeigen. Mittels vieler Beispiele aus dem Alltag führt sie vor, wie die Erderwärmung mit der Biodiversität, Wassermangel oder Entwaldung zusammenspielt. Dabei fehlt es auch nicht an positiven Maßnahmen wie etwa der gelungenen Reduktion ozonschädigender Substanzen durch die Weltgemeinschaft.
Zwei Medienstationen in Kooperation mit der ESA und Ars Electronica Solutions zeigen mit Aufnahmen von Erdbeobachtungssatelliten schrumpfende Seen, schmelzende Gletscher und die zunehmende Bodenversiegelung.
Ein Highlight der Ausstellung ist der immersive und interaktive Erlebnisraum „The Future Simulator“. Die BesucherInnen können dort durch ihr Abstimmungsverhalten die Zukunft beeinflussen und sehen unmittelbar, wie sich ihre Entscheidungen auf unser Leben in den kommenden Jahren auswirken.
https://www.technischesmuseum.at/ausstellung/klima_wissen_handeln
Hörtipp
Natur aus dem Rhythmus
Wenn die Hasel blüht, beginnt für die Biologie der Vorfrühling. Doch viele solcher Ereignisse verschieben sich durch die globale Erhitzung. Heute liegt der durchschnittliche Blühbeginn der Hasel in Mitteleuropa einen ganzen Monat vor dem Durchschnitt der letzten 200 Jahre. Manche Organismen wie allergene Pflanze kommen gut mit der Verschiebung zurecht, andererseits gerät durch Spätfröste und Ähnliches das austarierte Verhältnis zwischen Blühphasen und Bestäubern oder zwischen Jägern und Beutetieren aus dem Gleichgewicht. Die DIMENSIONEN haben nachgefragt, wie sich der Rhythmus der Natur verändert.
https://oe1.orf.at/programm/20240306#752287/Natur-aus-dem-Rhythmus