Wunschzeit
(aus: Ö1-GEHÖRT, Dezember 2019)
„Das Einkommen der Kinder richtet sich nach dem Einkommen des Vaters… na dann, Papa, hopp-hopp!“ Also sprach der 10jährige kürzlich, während er einen Zeitungsartikel über soziale Ungleichheit las. Dies hat mich auf verqueren Wegen zu dieser Kolumne mit drei Wünschen für das analoge wie digitale Leben gebracht.
 Da im Österreich des Jahres 2019 Aufstiegschancen – siehe Schnittlauchlocke – noch immer ähnlich festgeschrieben sind wie im Ständestaat, wünsche ich mir, dass Bildung und Einkommen ab sofort nicht mehr „erblich“ sind. Eine gesunde Gesellschaft braucht die Gehirne von allen Menschen und kann es sich aus vielerlei Gründen nicht leisten, allzu viele durch Nichtbeachtung zu demütigen und zurück zu lassen. So wie es Pädagogenkommissionen schon in den 70er Jahren vorgeschlagen haben, müssen wir Kinder nicht mit 10 in Schulzweige selektieren, wenn wir darauf vertrauen, dass Bildung etwas bewirken kann. Man braucht keine Glaskugel, um zu prophezeien, dass neue digitale Werkzeuge wie Künstliche Intelligenz oder auch nur die Einordnung von Nachrichten in Sozialen Medien Kompetenzen braucht, die über das Lenken eines Mopeds hinausgehen.
Da im Österreich des Jahres 2019 Aufstiegschancen – siehe Schnittlauchlocke – noch immer ähnlich festgeschrieben sind wie im Ständestaat, wünsche ich mir, dass Bildung und Einkommen ab sofort nicht mehr „erblich“ sind. Eine gesunde Gesellschaft braucht die Gehirne von allen Menschen und kann es sich aus vielerlei Gründen nicht leisten, allzu viele durch Nichtbeachtung zu demütigen und zurück zu lassen. So wie es Pädagogenkommissionen schon in den 70er Jahren vorgeschlagen haben, müssen wir Kinder nicht mit 10 in Schulzweige selektieren, wenn wir darauf vertrauen, dass Bildung etwas bewirken kann. Man braucht keine Glaskugel, um zu prophezeien, dass neue digitale Werkzeuge wie Künstliche Intelligenz oder auch nur die Einordnung von Nachrichten in Sozialen Medien Kompetenzen braucht, die über das Lenken eines Mopeds hinausgehen.
Kürzlich klagte Freund Paul darüber, dass seine Studierenden nur mehr furchtbare Zukunftsvisionen vor Augen haben, veritable Dystopien über den Untergang des Abendlandes unter Silicon Valleyscher Technokratur. Aber ihnen fehle jegliche positive Utopie, wie wir die Welt zum Positiven gestalten könnten. Genau das braucht eine Gesellschaft jedoch, um nicht in passiver Depression zu verharren. Also predige ich: Habet den Mut zu positiven Vorstellungen von der Zukunft. (Und so viel sei verraten: Ö1 wird dem im Lauf des nächsten Jahres Zeit widmen.)
Und noch etwas ganz Persönliches, was mich kürzlich auf der Makerfaire in Rom, der Präsentationsbühne für Macher, mehr als irritierte und fast zornig machte: Da ging man an Ständen mit Menschen vorbei, die in der Mehrzahl nur in ihre Smartphones starrten, statt den Besucherinnen ihre wunderbaren Ideen nahezubringen. Das war spooky. So leget das Teufelszeug auch mal weg – und ganz ehrlich: Daheim stecken wir bereits mitten in einem digitalen Diätprogramm. Alle. Damit Schnittlauchlocke öfter die Zeitung liest, als nur dann, wenn er mehr Einkommen vom Papa fordert.
Kaputt
(aus: Ö1-GEHÖRT, November 2019)
Wolfi, ein Vertrauter aus Salzburger Zeiten, antwortete auf die erste Digitalisierungswelle im Büro (90er Jahre) mit schlechten Vibes. Er hasste das neue Schnittprogramm für Radiobeiträge. Wenn er hinter mir vorbei ging, stürzte das System ab. Wir trafen uns daraufhin vorwiegend im Wirtshaus.
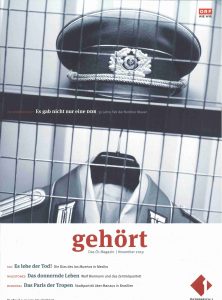 Daheim gibt es eine Dame, deren Namen ich vorläufig in der Kolumne nicht mehr erwähnen darf. Jüngst ging unter ihren Händen das Notebook ein, zuvor hatte sie eine kleine Küchenmaschine ruiniert, und ein paar Monate zuvor köpfelten zwei Smartphones kurz hintereinander in technosuizidaler Absicht auf den Betonboden. Ich gab ihr wiederholt den Namen „Gerätetod“. Sie antwortete mit zwei Wörtern: dem Vor- und Nachnamen einer prominenten Scheidungsanwältin. Seither vermeide ich beim weiblichen Teil der Familie jegliche Anspielungen auf den saumäßigen Umgang mit Ressourcen.
Daheim gibt es eine Dame, deren Namen ich vorläufig in der Kolumne nicht mehr erwähnen darf. Jüngst ging unter ihren Händen das Notebook ein, zuvor hatte sie eine kleine Küchenmaschine ruiniert, und ein paar Monate zuvor köpfelten zwei Smartphones kurz hintereinander in technosuizidaler Absicht auf den Betonboden. Ich gab ihr wiederholt den Namen „Gerätetod“. Sie antwortete mit zwei Wörtern: dem Vor- und Nachnamen einer prominenten Scheidungsanwältin. Seither vermeide ich beim weiblichen Teil der Familie jegliche Anspielungen auf den saumäßigen Umgang mit Ressourcen.
Abseits dieser familiären Verwerfungen haben wir ein ganz generelles Problem. Wunderdinge wie Smartphones lassen sich kaum mehr reparieren. Weil die Erzeuger das auch nicht wollen. Wenn Sie einmal ein beschädigtes iPhone öffnen, werfen Sie zuerst die Nerven, danach das Gerät weg. Mit großen ökologischen Kosten: Die größten klimarelevanten CO2-Emissionen, rund dreiviertel davon, entstehen bei der Herstellung. So hat die Smartphone-Produktion laut Greenpeace zw. 2007 und 2017 den Energie-Jahresbedarf von Indien verschlungen. (Nachdem wir Smartphones im Schnitt alle 20 Monate austauschen, selbst wenn sie funktionieren, würde es dem Klima auch schon helfen, sie länger zu nutzen.)
Reparieren ist bei hohen Arbeitskosten wie in Österreich darüber hinaus teuer. Schweden steuert der Ressourcenverschwendung längst entgegen. Es verrechnet auf Reparaturen keine Mehrwertsteuer. Die EU will nun Hersteller zwingen, ihre Geräte – nicht nur Handys – reparaturfähig zu bauen. Schließlich stecken in einem Smartphone rund 60, zum Teil sehr wertvolle Elemente, und viele der ausgedienten Telefone landen in einem Schrank und werden vergessen.
Wer wie ich als Heimwerker gefürchtet ist, der kann auch Reparaturcafés nützen. Dort werden, quer durch das Land, kaputte Kaffeemaschinen oder marode Föne vielfach mit einfachsten Mitteln in Stand gesetzt. Oft fehlt es nur an einem Bauteil, das ein paar Cent kostet.
Gutes CO2-Karma ist Ihnen damit auf jeden Fall sicher.
Online-Shopping-Schelte
(aus: Ö1-GEHÖRT, Oktober 2019)
Jüngst verfiel ich in eine unschöne Einkaufswut. In Folge tröpfelten ein paar Tage später circa 5 Pakete ein. Ich hatte ja bequem online bestellt. Dies nutzten meine #fridaysforfuture-Buben, um mich kräftig zu schimpfen. Von wegen CO2-Abdruck und Nachhaltigkeit und Karton-Tohuwabohu.
 Schuldbewusst nahm ich die Schelte entgegen und gelobte mich zu bessern. Dann klopfte aber der Wissenschaftsjournalist in mir an die Schädeldecke und verlangte nach Fakten.
Schuldbewusst nahm ich die Schelte entgegen und gelobte mich zu bessern. Dann klopfte aber der Wissenschaftsjournalist in mir an die Schädeldecke und verlangte nach Fakten.
Zu meiner eigenen Überraschung ist Online-Shopping nicht a priori amoralisch, wenn man die Erde nicht weiter aufheizen will. Ein Paar Schuhe verursacht bei der Zustellung ein halbes Kilogramm CO2-Emissionen. Damit kommt man mit einem Mittelklassewagen knapp drei Kilometer weit. Lokal einkaufen rentiert sich nach Meinung des Deutschen Ökologie-Instituts klimatechnisch dann, wenn das Geschäft nicht weiter als 900 Meter entfernt liegt.
Aber das ist noch kein Freispruch für den elektronischen Fernhandel. Zum einen werden nicht nur relativ kleine Schuhkartons versandt, sondern auch große Einrichtungsgegenstände oder Fernseher. Zum anderen werden zwei von drei Schuhen zurückgeschickt, bei Kleidung rechnet man mit einer Retourenquote von 50 Prozent. Und jetzt ist die nette Klimabilanz dahin.
Online-Shoppen ist also nur dann günstiger, wenn man genau weiß, was man braucht, wenn die Ware standardmäßig verschickt wird und der Zusteller die Lieferadresse nicht mehrfach anfahren muss.
Noch gar nicht geredet haben wir davon, dass jede zweite Online-Bestellung den amerikanischen Superkonzern Amazon noch reicher und tendenziell zum Monopol macht. Außerdem muss er nicht nach hierzulande geltenden Regeln spielen. Während österreichische Händler für die Entsorgung der Verpackungsmaterialien einen Beitrag zahlen müssen, blechen wir für die Entsorgung von Kartonagen aus dem Ausland selber. Eine umfassendere Bilanz des Online-Shoppens ist also durchaus zwiespältig.
Immerhin konnte ich mich argumentativ bei meinen Buben rehabilitieren. Schnittlauchlocke, ein fanatischer Kicker, bestellte sich personalisierte Fußballschuhe im Netz (geht nur dort). Als ich die Versandbestätigung bekam, musste ich ein bissl grinsen: Sie kam aus Ho-Chi-Minh.
Unsere neue Frau
(aus: Ö1-GEHÖRT, September 2019)
„Ihr sollt keine anderen Göttinnen haben neben mir!“ Also hätte die Liebste gesprochen, wäre sie etwas bibelfester. Stattdessen sagte sie nur: „Mir kommt keine andere Frau ins Haus!“ Damit meinte sie unter anderem, aber vor allem Alexa. Alexa ist zum Synonym für Sprachsteuerung aus dem Hause eines Online-Riesen geworden. Das Gerät in Form eines Lautsprechers lässt sich über Sprachbefehle steuern und spricht mit weiblicher Stimme zurück. Sie erzählt Witze und spielt etwa auf Wunsch auch das Programm von Ö1 ab.
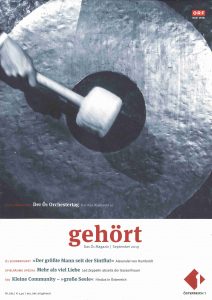 Das Verbot erteilte die Frau meines Vertrauens vor mehr als zwei Jahren. Deshalb setzte ich auf ihre Vergesslichkeit und bestellte Alexa vor einem Monat um den Preis eines Bio-Huhns. Ich argumentierte, ich müsse wissen, worüber ich in meiner digitalen Welt berichte. Die Liebste zog ein Schnoferl und bestellte postwendend ein gefühltes halbes Dutzend Schuhe um den Preis eines E-Bikes.
Das Verbot erteilte die Frau meines Vertrauens vor mehr als zwei Jahren. Deshalb setzte ich auf ihre Vergesslichkeit und bestellte Alexa vor einem Monat um den Preis eines Bio-Huhns. Ich argumentierte, ich müsse wissen, worüber ich in meiner digitalen Welt berichte. Die Liebste zog ein Schnoferl und bestellte postwendend ein gefühltes halbes Dutzend Schuhe um den Preis eines E-Bikes.
Jetzt spielt Alexa die Wunschlieder meiner Kinder oder erzählt ihnen Witze. Ich rede recht einsilbig mit ihr und sage meist nur, „Alexa, leiser!“, oder „Alexa, stopp!“. Noch öfter ziehe ich den Stecker, weil Alexa ziemlich neugierig ist und immer zuhört, was wir in der Wohnküche so reden.
Interessanterweise sprechen die meisten Sprachassistenzsysteme, auch Cortana oder Siri, mit Frauenstimme. Das hat jetzt zu einer gut begründeten Kritik von Seiten der UNO geführt. Alexa und ihre Kolleginnen sind hilfsbereit, geduldig und vor allem unterwürfig. Da man ihnen stimmlich ein weibliches Geschlecht gibt, verstärken sie so noch Geschlechterklischees. Schließlich erzeugt Sprache Wirklichkeit. Manche Institutionen experimentieren deshalb schon mit geschlechtsneutralen künstlichen Stimmen für Maschinen.
Die aktuelle Schieflage in Sachen Robotergeschlecht kommt wohl auch daher, dass nur 12% der Beschäftigten in der IT Frauen sind. Oder wie der „Österreichische Rat für Robotik“ kürzlich auf Twitter sinngemäß postete: Wenn in Zukunft Roboter den Lauf der Welt mitbestimmen, sollten sie nicht nur von Männern programmiert werden.
In der Zwischenzeit lernen wir den Buben kochen, waschen und gärtnern. Damit sie niemals auf Alexas angewiesen sind, egal, ob diese Maschinen mit weiblicher oder männlicher Stimme sprechen.
Pony-Fetisch
(aus: Ö1-GEHÖRT, August 2019)
Es kommt nicht mehr oft vor. Aber manchmal verblüffen mich Dinge im Netz schon noch.
Jüngst war ich mit meinen drei Brüdern auf einer kroatischen Insel. Wir hatten kein Programm, weil alle sehr erschöpft waren. Wir wollten einfach die gemeinsame Zeit mit ansonsten zwecklosen Verrichtungen feiern. Da trabte ein Pony an uns vorbei. Das erinnerte Christian und Robert an eine Szene, die sie im Netz gesehen hatten. Flugs zog einer das Smartphone aus der Tasche und startete YouTube.
 Im folgenden Video trafen sich Menschen bei einem Festival in den Südstaaten, um sich als Ponys zu verkleiden und vor einen Sulky spannen zu lassen. Darin saß zumeist eine Reiterin. Hurtig und glücklich hüpfte das Pseudo-Rösslein vor seinem Gefährt her, immer wieder wohlwollend angetrieben von der steuernden Dame, die ihre sekundären Geschlechtsmerkmale mit einem opulenten Kostüm in Schwarz und Rot betont hatte. Das menschliche Pony wiederum trug sein Zaumzeug im Mund, als wäre der Knebel im Maul das Selbstverständlichste auf der Welt. Und es wurde mit seiner ungewöhnlichen Neigung durchaus nicht allein gelassen. Seine Wege kreuzten sich mit einem Pferdchen, das so wie die Evolution es geschaffen hatte unbekleidet durch den Park trabte. Dann wiederum mühte sich ein Latex-Pony sichtlich dabei ab, einer überdimensionalen Reiterin mit seiner Zugkraft zu gefallen.
Im folgenden Video trafen sich Menschen bei einem Festival in den Südstaaten, um sich als Ponys zu verkleiden und vor einen Sulky spannen zu lassen. Darin saß zumeist eine Reiterin. Hurtig und glücklich hüpfte das Pseudo-Rösslein vor seinem Gefährt her, immer wieder wohlwollend angetrieben von der steuernden Dame, die ihre sekundären Geschlechtsmerkmale mit einem opulenten Kostüm in Schwarz und Rot betont hatte. Das menschliche Pony wiederum trug sein Zaumzeug im Mund, als wäre der Knebel im Maul das Selbstverständlichste auf der Welt. Und es wurde mit seiner ungewöhnlichen Neigung durchaus nicht allein gelassen. Seine Wege kreuzten sich mit einem Pferdchen, das so wie die Evolution es geschaffen hatte unbekleidet durch den Park trabte. Dann wiederum mühte sich ein Latex-Pony sichtlich dabei ab, einer überdimensionalen Reiterin mit seiner Zugkraft zu gefallen.
Pony-Fetisch nennt die Szene diese Spiele. Man findet sie auch in Österreich. Eingeweihte sprechen von Pet Play. Die tierische Verkleidung muss also nicht auf Huftiere beschränkt sein. Es gibt Pet Play auch ohne Sado-Maso. Die verkleiden sich einfach als Fuchs oder Hase, weil sie so gern Tiere wären. Früher, in Vornetzzeiten, saßen die Menschen in ihren flauschigen Kostümen wohl einsam daheim und wähnten sich auf einer roten Liste origineller Neigungen. Nunmehr finden Pony-Fetischistinnen, Wahl-Truthähne und Wölfe im Kunstpelz leicht ihresgleichen. All das dank Internet.
von Pet Play. Die tierische Verkleidung muss also nicht auf Huftiere beschränkt sein. Es gibt Pet Play auch ohne Sado-Maso. Die verkleiden sich einfach als Fuchs oder Hase, weil sie so gern Tiere wären. Früher, in Vornetzzeiten, saßen die Menschen in ihren flauschigen Kostümen wohl einsam daheim und wähnten sich auf einer roten Liste origineller Neigungen. Nunmehr finden Pony-Fetischistinnen, Wahl-Truthähne und Wölfe im Kunstpelz leicht ihresgleichen. All das dank Internet.
Mir reicht die straighte sommerliche Verkleidung mit Badehose. Aber wenn Sie jetzt ein neues Hobby für sich entdecken: Das Netz bietet Ihnen jede Menge Workshops und Stammtische für Pet Play an.
Stalker-Komödie
(aus: Ö1-GEHÖRT, Juli 2019)
Nehmen Sie am besten Papier und Bleistift zur Hand. Das Stück, das ich Ihnen gleich schildern werde, hat ungefähr so viele Personen und Türen wie eine Komödie von Feydeau.
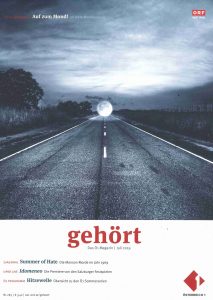 Manuela hat auf dem Handy ihres Sohnes Raphael eine ihr bislang unbekannte App entdeckt: Tellonym. Wenn man sie installiert, kann man anderen anonym Fragen stellen bzw. bekommt auch selbst Fragen von Menschen, deren Identität man bestenfalls vermuten kann. Von der Theorie her klingt das nett, weil Tellonym ein Werkzeug zum Einheben von Meinungen „zur Arbeit oder zu einem Projekt“ sein könnte. Aber was machen 13jährige damit? Logo, sie fragen: „Bist du verliebt?“ oder „Stehst du noch auf J.?“ Oder man nutzt Tellonym, wie im Fall von Manuelas Sohn, als Mobbing-Werkzeug und haut dem Buben aus sicherer Deckung Gemeinheiten um die Ohren, dass es nur so kracht im Gebälk des keimenden Selbstbewusstseins. Manuela erzählte der Liebsten also von dieser Drecksschleuder Tellonym. Schließlich ist unser Großer einer der besten Freunde von Raphael. Natürlich entdeckte die Frau meines größten Vertrauens die App auch auf dem Handy unseres Sohnes. Sofort hat sie sich unter Aurelia15 bei Tellonym registriert und stalkt jetzt den Großen. Aber, der kann mit dem Unding eh ziemlich gut umgehen und entblößt sich auf Fragen wie „Hast du schon mal besondere Gefühle gehabt?“ nicht, sondern übt sich in einer für unsere Familie sonst nicht üblichen, ungeahnt gekonnten Diplomatie (Respekt, Großer!).
Manuela hat auf dem Handy ihres Sohnes Raphael eine ihr bislang unbekannte App entdeckt: Tellonym. Wenn man sie installiert, kann man anderen anonym Fragen stellen bzw. bekommt auch selbst Fragen von Menschen, deren Identität man bestenfalls vermuten kann. Von der Theorie her klingt das nett, weil Tellonym ein Werkzeug zum Einheben von Meinungen „zur Arbeit oder zu einem Projekt“ sein könnte. Aber was machen 13jährige damit? Logo, sie fragen: „Bist du verliebt?“ oder „Stehst du noch auf J.?“ Oder man nutzt Tellonym, wie im Fall von Manuelas Sohn, als Mobbing-Werkzeug und haut dem Buben aus sicherer Deckung Gemeinheiten um die Ohren, dass es nur so kracht im Gebälk des keimenden Selbstbewusstseins. Manuela erzählte der Liebsten also von dieser Drecksschleuder Tellonym. Schließlich ist unser Großer einer der besten Freunde von Raphael. Natürlich entdeckte die Frau meines größten Vertrauens die App auch auf dem Handy unseres Sohnes. Sofort hat sie sich unter Aurelia15 bei Tellonym registriert und stalkt jetzt den Großen. Aber, der kann mit dem Unding eh ziemlich gut umgehen und entblößt sich auf Fragen wie „Hast du schon mal besondere Gefühle gehabt?“ nicht, sondern übt sich in einer für unsere Familie sonst nicht üblichen, ungeahnt gekonnten Diplomatie (Respekt, Großer!).
Aber natürlich geht die Geschichte weiter: Die Liebste hat Brigitte informiert, ihres Zeichens auch besorgte Mutter eines pubertierenden Sohnes namens Benedikt. Da die aber mit den digitalen Werkzeugen nicht so firm ist, muss Aurelia15 Brigittes Sohn jetzt auftragsstalken und weiterleiten, mit welchen Gemeinheiten und Liebesgeschichten Benedikt in seinem virtuellen Leben zu kämpfen hat.
Der Große hat Aurelia15 immerhin sehr schnell enttarnt. (Noch einmal Respekt, Großer!) Keine Ahnung, wie lange ich anonym bleiben kann. Ich stalke die Liebste nämlich jetzt virtuell unter Benny04. Ich weiß ja nicht, ob sie bei ihren häufigen Ausflügen auf Tellonym nicht auf blöde Gedanken kommt.
Schiefe Gesichter
(aus: Ö1-GEHÖRT, Juni 2019)
Sie sind nicht gerecht. Sie sind undurchschaubar. Und sie sind bald allgegenwärtig. Verzeihen Sie, dass ich Sie mit diesem Unbegriff „Algorithmus“ belästigen muss. Diese Rechenanleitungen stecken in allem, was sich Software oder noch spektakulärer „Künstliche Intelligenz“ nennt. Aber wie problematisch und schlecht diese Kochrezepte für Computer sein können, zeigt sich zum Beispiel an der Gesichtserkennung, wie sie von der Polizei, auf Flughäfen oder natürlich von den Internetgiganten eingesetzt wird.
 „Naja, bei mir würde das Programm aufgrund meiner Hautfarbe wohl eh nicht funktionieren“, twittert etwa Aisha. Sie ist dunkelhäutig, wie man auf ihrem Profilbild sieht. Und sie hat Recht. Die MIT-Forscher Joy Buolamwini hat im Vorjahr gezeigt, dass die verbreitetsten Programme nur weiße Männer gut erkennen, weiße Frauen schon schlechter und bei andersfarbigen Menschen fiel die Treffsicherheit ins Bodenlose. Warum? Weil die Systeme halt vorwiegend mit weißen Männern trainiert wurden. Microsoft und das chinesische Face++ reagierten sofort und senkten die Fehlerraten auf nahe null. Amazon hingegen, das sein Gesichtserkennungsprogramm Rekognition u.a. an die US-Polizei verkauft, tat nichts gegen den Fehler, wie netzpolitik.org berichtete.
„Naja, bei mir würde das Programm aufgrund meiner Hautfarbe wohl eh nicht funktionieren“, twittert etwa Aisha. Sie ist dunkelhäutig, wie man auf ihrem Profilbild sieht. Und sie hat Recht. Die MIT-Forscher Joy Buolamwini hat im Vorjahr gezeigt, dass die verbreitetsten Programme nur weiße Männer gut erkennen, weiße Frauen schon schlechter und bei andersfarbigen Menschen fiel die Treffsicherheit ins Bodenlose. Warum? Weil die Systeme halt vorwiegend mit weißen Männern trainiert wurden. Microsoft und das chinesische Face++ reagierten sofort und senkten die Fehlerraten auf nahe null. Amazon hingegen, das sein Gesichtserkennungsprogramm Rekognition u.a. an die US-Polizei verkauft, tat nichts gegen den Fehler, wie netzpolitik.org berichtete.
Leider haben derlei fehlerhafte Algorithmen Folgen. Frauen und Nicht-Weiße werden etwa am Flughafen öfter bei der Kontrolle durchfallen oder bei der Verbrechersuche häufiger fälschlicherweise ausgeworfen.
Mit dem Verweis, es handle sich um Firmengeheimnisse, erlauben die Firmen meist auch keinen Einblick in ihre Programme. So bleiben sie in ihrer ganzen Fehlerhaftigkeit intransparent.
Die EU versucht mit ihren im April veröffentlichten Richtlinien für Künstliche Intelligenz gegenzusteuern. Auch wenn die zahlreichen Industrievertreter die Ethiker und Expertinnen in der High Level Expert Group on Artificial Intelligence zu vielen Kompromissen gezwungen haben, sprechen sich die Empfehlungen doch deutlich für gerechte, ausgewogene und transparente Algorithmen auf Basis europäischer Werte aus.
Jetzt muss sich nur noch die europäische Politik dazu entscheiden, die Richtlinien als Verpflichtung festzuschreiben. Immerhin geht es um unsere Zukunft.
Schlimme Dates
(aus: Ö1-GEHÖRT, Mai 2019)
Die schlimmsten Dates, die ich jemals hatte, sind die Updates. Es beginnt mit einem kleine Stupser am Bildschirm, nach dem Motto: „Du, die Kiste braucht frischen Esprit, lass uns das doch mal machen!“ Nachdem das Notebook gerade so gut läuft, möchte man nichts ändern. Also wird das Drängen aus der Maschine immer heftiger, bald lassen sich die Aufforderungen nur mehr mit einem doppelten digitalen Salto wegklicken. Und irgendwann gibt man auf und nach. Und lässt das Update zu.
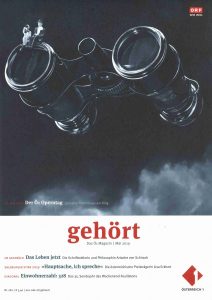 Und danach geht nichts mehr. Jetzt beginnt auf einem anderen Gerät das Suchen, wie man den Computer wieder in den veralteten, aber wenigstens funktionierenden Zustand zurücksetzen kann. Etwa 8 Tage später lässt sich der Kasten – im besten Fall – wieder hochfahren.
Und danach geht nichts mehr. Jetzt beginnt auf einem anderen Gerät das Suchen, wie man den Computer wieder in den veralteten, aber wenigstens funktionierenden Zustand zurücksetzen kann. Etwa 8 Tage später lässt sich der Kasten – im besten Fall – wieder hochfahren.
Ähnlich ist es beim Navi. Seit Monaten drängt es mich mit dem Hinweis, die Karte für das Straßennetz sei veraltet, es auf den neuesten Stand zu bringen. Weil ich mich weigere, täuscht es nun Demenz vor. Obwohl ich mich mitten im Weinviertel aufhalte, zeigt es mich am Schwarzen Meer. Nun muss ich also „updaten“. Diese Bevormundung geht mir schwer gegen den Strich. Es ist doch meine Sache, ob ich in die Irre fahre. Gerade über Umwege habe ich in meinem Leben schon viel entdeckt.
Noch schlimmer ist es bei Apps am Smartphone. Da wird das Update oft zum Vorwand, mir neue Zugriffsrechte abzuringen. Kurz zugestimmt, und schon darf die Taschenlampe am Handy wissen, wessen Kontaktdaten ich gespeichert habe. Das Hauptargument, Updates seien nicht zuletzt nötig, um Sicherheitslücken zu stopfen, ist auch nicht immer überzeugend: Warum lässt man überhaupt so viele Lücken? Updates sind viel eher der indirekte Beweis, dass wir, die KonsumentInnen, Benutzer und Testkaninchen gleichzeitig sind.
Am skurrilsten hat es meinen Fußballkollegen und Journalisten Peter getroffen. Er testete ein amerikanisches Elektromobil. Es holt sich sein Update zu beliebigen Zeiten vom Himmel und begann just damit, als Peter in eine Tiefgarage einfuhr. Daraufhin mochte es sich keinen Zentimeter mehr bewegen. Die Firma schickte einen Spezialwagen, der das E-Mobil gerade ein paar Zentimeter anhob und aus dem updatelosen Bunker schleppte. Da ging das Update angesichts des Himmels wieder weiter. Und das Auto ließ sich schlussendlich wieder starten.
Vollautomatisiert
(aus: Ö1-GEHÖRT, April 2019)
Im Nachhinein betrachtet war es wohl ein Fehler. Ich habe Freund Stefan von den kleinen programmierbaren Mikrocomputern mit WLAN erzählt. Diese Dinger kosten gerade mal zwei bis drei Euro. Stefan, ein Techniker von Herzen, hat daraufhin sofort Sensoren für Temperatur, Licht und Luftfeuchtigkeit in der Wohnküche installiert und sich die Werte am Handy anzeigen lassen. Als er merkte, dass bei jedem Öffnen der Wohnungstür die Luftfeuchtigkeit fällt und man so das Gehen und Kommen dokumentieren kann, ist er in einen veritablen Überwachungsrausch verfallen. In dessen charmantester Ausprägung hat Stefan einen Blubberzähler gebaut, mit dem sich die Gasblasen beim Vergären von Bier zählen und allezeit auf das Handy schicken lassen. Dadurch weiß der Hobbybrauer immer und überall Bescheid, wie es um den Gärprozess steht. Auch hat Stefan den altmodischen Ferraris-Stromzähler mit minimalem Aufwand in ein Smartmeter verwandelt, um den Stromverbrauch aufzuzeichnen.
 Seit in seinem Wohnhaus eingebrochen wurde, sind auf die Eingänge der Wohnung zwei Kameras gerichtet, die er über das Handy bedienen kann. Und wenn ihm die Kameras eine Bewegung melden, kann er vom Smartphone aus eine Lärmmaschine anwerfen – zur Abschreckung der Einbrecher. Jüngst lugte er um halb acht Uhr früh vermittels Handy in die Wohnung und beobachtete seine Kinder, als sie gerade zur Schule aufbrachen. Stefan schreckte sie in väterlicher Zärtlichkeit kurz mit der ohrenbetäubenden Elektrotröte. Die Kinder schrien angeblich sowas wie „Chill dein Leben, Papa“, in die Kamera. Ob er auch seine Ehe schon vollautomatisiert hat, weiß ich nicht. Ich warte aber gespannt auf die nächsten Schritte.
Seit in seinem Wohnhaus eingebrochen wurde, sind auf die Eingänge der Wohnung zwei Kameras gerichtet, die er über das Handy bedienen kann. Und wenn ihm die Kameras eine Bewegung melden, kann er vom Smartphone aus eine Lärmmaschine anwerfen – zur Abschreckung der Einbrecher. Jüngst lugte er um halb acht Uhr früh vermittels Handy in die Wohnung und beobachtete seine Kinder, als sie gerade zur Schule aufbrachen. Stefan schreckte sie in väterlicher Zärtlichkeit kurz mit der ohrenbetäubenden Elektrotröte. Die Kinder schrien angeblich sowas wie „Chill dein Leben, Papa“, in die Kamera. Ob er auch seine Ehe schon vollautomatisiert hat, weiß ich nicht. Ich warte aber gespannt auf die nächsten Schritte.
Auch meinen Nachbarn hat es erwischt. Seit zwei Monaten besitzt er ein „Wischhandy“, das er nicht einmal beim Essen aus der Hand legt. Jüngst ließ uns ein Kuckuck am abendlichen Tisch zusammenzucken. Den hat Hans beim Herumspielen als Klingelton entdeckt. Er ist Waidmann. Und wenn er ins Revier geht und einen Anruf bekommt, so seine Argumentation, werden Reh und Hirsch nicht verschreckt. Den Lautlos-Knopf kennt er nämlich noch nicht. Also, sollten Sie in der Gegend des niederösterreichischen Kaumberg einen Hirsch mit Tinnitus treffen, dann wissen Sie wenigstens, dass der Kuckuck daran schuld ist.
Maschinendämmerung
(aus: Ö1-GEHÖRT, März 2019)
Als Roboter hat man es auch nicht immer lustig. Ein Sicherheitsroboter in San Francisco wurde in eine Plane gewickelt und mit Grillsauce beschmiert, in Osaka verprügelten drei Buben in einem Einkaufszentrum einen Humanoiden, und in Moskau bearbeitete ein Mann einen Roboter mit einem Baseballschläger. Am schlimmsten traf es einen autostoppenden Roboter in San Francisco. Dem rissen Unbekannte den Kopf aus. Fälle wie diese hat kürzlich die New York Times dokumentiert.
 Der US-Kabarettist Aristotle Georgeson nutzt das Roboter-Verdreschen sogar als PR: er postet auf Instagram immer wieder Szenen, in denen Roboter schwer draufzahlen. Diese Videos seien am populärsten unter all den Filmen, die er online stellt, sagt er. Irgendwie lösen die Maschinen ungute Emotionen in uns aus. Und diese Emotionen haben wenig mit der Maschinenstürmerei des 19. Jahrhunderts zu tun, als Weber und andere Arbeiter – für ihr Überleben als Bedrohung empfundene -Gerätschaften wie Webstühle zertrümmerten.
Der US-Kabarettist Aristotle Georgeson nutzt das Roboter-Verdreschen sogar als PR: er postet auf Instagram immer wieder Szenen, in denen Roboter schwer draufzahlen. Diese Videos seien am populärsten unter all den Filmen, die er online stellt, sagt er. Irgendwie lösen die Maschinen ungute Emotionen in uns aus. Und diese Emotionen haben wenig mit der Maschinenstürmerei des 19. Jahrhunderts zu tun, als Weber und andere Arbeiter – für ihr Überleben als Bedrohung empfundene -Gerätschaften wie Webstühle zertrümmerten.
Vor allem humanoide Roboter, die in Figur und äußeren Merkmalen an uns angelehnt sind, bereiten uns Unbehagen. Sie sind uns ähnlich, aber doch nicht wir. Das provoziert das mentale Korsett des Steinzeitmenschen, von dem wir uns bis jetzt nicht ganz lösen können. Er schaltet auf Abwehr, auch mit Gewalt.
Eigentlich gehen wir mit Robotern damit genauso um wie mit Mitmenschen, meint die Kognitionswissenschafterin Agnieszka Wykowska. Da gibt es die, die drinnen sind in der selbstdefinierten Stammesgruppe, und die Außenstehenden, denen wir manchmal mit wenig Feingefühl begegnen.
Kinder in ihrer Ungezähmtheit reagieren ähnlich. In einem Kindergarten behandelten die Kleinen einen Roboter ganz mies und traten ihn, bis ihm die Pädagogin einen Namen gab. Ab diesem Zeitpunkt hörte alle Aggression auf. Als „Tim“ oder „Betty“ rückte er plötzlich näher.
So werden Roboter zu einem Mittel der menschlichen Selbsterkenntnis. Ob uns das ehrt, sei dahingestellt. Wir könnten die vermeintlich menschlich wirkenden Geräte ja auch einfach als das wahrnehmen, was sie sind: tumbe Maschinen für Tätigkeiten, die wir nicht mögen. Und wenn nicht, sollten wir uns wenigstens fürchten, dass sie sich irgendwann erinnern, wer die Hand gegen sie erhoben hat. Und zurückschlagen.
Das Stundenhotel als Technologieopfer
(aus: Ö1-GEHÖRT, Februar 2019)
Neue Technologien leben vielfach von Versprechen. Sie sind wahre Fantasiemaschinen, zeichnen sie uns doch die Zukunft – meist – in den buntesten Farben, getränkt mit nachgerade biblischer Glückseligkeit. Wo immer derzeit die Wörtchen smart oder Künstliche Intelligenz drinstecken, verbirgt sich die Verheißung auf Erlösung von vielen weltlichen Problemen – von der Umweltverschmutzung über zu ungenaue medizinische Diagnosen bis hin zu mehr Gerechtigkeit vor Gericht. Dass das Silicon Valley mit dieser grandiosen Story die Demokratie erodiert, darüber habe ich schon mehrfach lamentiert. Darum beschränke ich mich heute auf das fantasieanregende Element und die netten Erzählungen, die emerging technologies mitliefern.
 Eine meiner liebsten Glaskugel–Studien dazu haben jüngst Forscher aus Oxford und Surrey publiziert. Sie prophezeien, dass autonome Autos das althergebrachte Stundenhotel abschaffen werden. Der sexuelle wird sich demnach in den Straßenverkehr verlagern. Allerdings nur in privaten autonomen Vehikeln. Carsharing-Anbieter werden ihre selbstfahrenden Wägen wohl mit Kameras überwachen und allzu leibliche Aktivitäten vermutlich per „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ verbieten.
Eine meiner liebsten Glaskugel–Studien dazu haben jüngst Forscher aus Oxford und Surrey publiziert. Sie prophezeien, dass autonome Autos das althergebrachte Stundenhotel abschaffen werden. Der sexuelle wird sich demnach in den Straßenverkehr verlagern. Allerdings nur in privaten autonomen Vehikeln. Carsharing-Anbieter werden ihre selbstfahrenden Wägen wohl mit Kameras überwachen und allzu leibliche Aktivitäten vermutlich per „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ verbieten.
Während sich die einen wegen der Roboterautos also eher ausziehen, müssen sich andere warm anziehen: die Chauffeure von Sightseeing-Bussen nämlich und deren Reiseführer. Deren Aufgaben nämlich könnten autonome Autos übernehmen, die Touristen auf fixen Routen durch die Stadt kutschieren. Was dazu führen wird, dass vor Sehenswürdigkeiten wie dem Schloss Schönbrunn dann nicht mehr 30 Reisebusse stehen, sondern 600 selbstfahrende Fahrzeuge. Die brauchen natürlich viel mehr Platz und lösen kein Verkehrsproblem, wie oft versprochen. Sie verschärfen es nur, weil sie ja den sparsamen, ökologisch schonenden, kommunalen Verkehr durch noch mehr Individualverkehr ersetzen. Denn auch Elektroautos brauchen Platz.
Sehr attraktiv wirkt auch die Verheißung, über Nacht im Roboterauto reisen und sich quasi dem Ziel entgegenschlafen zu können.
Dieses Service gibt es allerdings schon längst. Nennt sich Schlafwagen. Hat Beinfreiheit. Und fährt (wie) auf Schienen. Das Bett machen muss man auch nicht selber.
Handy-Kollision
(aus: Ö1-GEHÖRT, Jänner 2019)
Da sag noch einmal einer, dass Smartphones menschliche Nähe verhindern. Im Gegenteil. Und ich meine jetzt nicht den Wisch- und Weg-Tinder-Sex, sondern eine richtige Begegnung. Das begab sich so: Die Dame kam mir mit gesenktem Kopf entgegen, den Blick fest am Handy. Just als wir uns am Gehsteig auf gleicher Höhe befanden, verriss sie plötzlich nach links. Ihr Smartphone bohrte sich irgendwo zwischen Leber und Magen in meinen Oberbauch. Die Fußgängerin entschuldigte sich wortreich, allerdings in einer Sprache, die ich bis heute nicht zuordnen kann. Es klang jedenfalls sehr nett. In jungen Jahren hätte ich sicherlich mit allen mir zur Verfügung stehenden fremdsprachlichen Grundkenntnissen geradebrecht, um die Dame zu einem Kaffee zu bewegen. Jetzt bin ich dank der Liebsten von diesem Zwang zur Pirsch erlöst.
Aber das Smartphone hätte mich und die Dame durchaus zusammenbringen können.
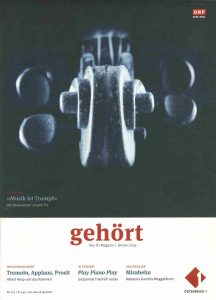 ForscherInnen sehen die Sache etwas nüchterner. Sie sprechen in diesem Zusammenhang von „abgelenktem Gehen“ – und der Grund der Ablenkung war natürlich nicht ich, sondern die Navigationsfunktion am Handy. Studien aus den USA legen nahe, dass durch das Smartphone verursachte Verletzungen bei Fußgängern seit 2010 um mehr als ein Drittel gestiegen sind. Insgesamt dürften sie für jeden zehnten Unfall zu Fuß verantwortlich sein. Österreichische Beobachtungen legen nahe, dass Ablenkung im Jahr 2016 an rund 1.500 Fußgänger-Unfällen schuld war.
ForscherInnen sehen die Sache etwas nüchterner. Sie sprechen in diesem Zusammenhang von „abgelenktem Gehen“ – und der Grund der Ablenkung war natürlich nicht ich, sondern die Navigationsfunktion am Handy. Studien aus den USA legen nahe, dass durch das Smartphone verursachte Verletzungen bei Fußgängern seit 2010 um mehr als ein Drittel gestiegen sind. Insgesamt dürften sie für jeden zehnten Unfall zu Fuß verantwortlich sein. Österreichische Beobachtungen legen nahe, dass Ablenkung im Jahr 2016 an rund 1.500 Fußgänger-Unfällen schuld war.
Der US-Bundesstaat Utah hat auf das globale Problem reagiert und verhängt Geldstrafen für abgelenktes Gehen in der Nähe von Geleisen. Auch Honolulu straft seit dem Vorjahr Menschen, die beim Überqueren der Straße auf ein elektronisches Gerät starren.
Noch schlimmer dürfte die Ablenkungswirkung im Auto sein. Wer beim Fahren etwa Kurznachrichten schreibt, soll angeblich so schlecht fahren, als hätte er 0.8 Promille Alkohol im Blut. Wohl auch deshalb ist abgelenktes Fahren bereits für mehr Straßentote verantwortlich als übermäßiges Trinken.
So gesehen ging die Kollision mit der Dame recht glimpflich aus – unfall- wie liebestechnisch.